[Hinweis: Bei dem Text handelt es sich um eine Kolumne, die regelmäßig in den Nachlieferungen des Loseblattwerkes „StiftungsManager“ erscheint. Im Blog wird ab 2015 die Kolumne veröffentlicht, sobald eine Nachlieferung die jeweils nächste, neue Kolumne gedruckt hat. So bleibt der aktuellste Text den Abonnenten des Verlages Dashöfer vorbehalten, und der nächstjüngste Text lädt hier gleichzeitig dazu ein, selbst Abonnent zu werden. Ihr Ansprechpartner im Verlag ist Mark Jacobs. Die nachstehende Kolumne erschien in der Nachlieferung 44 im Dezember 2015.]
Es war eine nie dagewesene Stimmung in der Berliner Philharmonie an jenem Novembersonntag 2015, als der Philharmonische Chor Berlin – übrigens zum ersten Mal in der 133-jährigen Geschichte des Chores – unter der Leitung von Jörg-Peter Weigle mit Solisten und mit der Staatskapelle Halle Das Buch mit sieben Siegeln aufschlug. 1937 schuf der österreichische Komponist dieses Oratorium mit Texten aus der Offenbarung des Johannes, im letzten Jahr, bevor mit dem „Anschluss“ Österreichs die Grenzen der Staaten in Europa sich völkerrechtswidrig zu verschieben begannen. Dass eine unsichere Zeit bevorstand, spürten die Zuhörer der Uraufführung – jeder konnte die Anzeichen erkennen. Im so genannten „Dritten Reich“ fühlten sich viele zurückgesetzt, schlechter behandelt als die Nachbarn, Erinnerungen an die Gräuel des zurückliegenden Krieges, Verwundungen körperlicher und seelischer (und geistiger) Art, Wirtschaftskrise und Inflation, Straßenkämpfe zwischen Kommunisten und Nazis, zwischen „Rothemden“ und „Braunhemden“, und Reparationszahlungen ließen das Stimmungsbarometer nicht gerade steigen. Für alles, was folgte, war das alles schon als Erklärung eine voller Lücken, als Rechtfertigung gänzlich ungeeignet. Die Stiftungen hatten zu dieser Zeit noch keine Möglichkeit, die Gesellschaft dauerhaft zu befrieden. Zu schwach war das Verständnis der vielen Stiftungen untereinander von einem gemeinsamen Anliegen, zu groß das Misstrauen gegen zentralistische Tendenzen, gegen Datenmissbrauch und Instrumentalisierung gegen stiftungsfremde Zwecke. Davon später noch mehr. Wir sind ja zunächst noch bei Stimmungen. Es ist keine Kaffeesatzleserei, wenn wir unserer Gesellschaft für die nächsten Jahre schwierige Zeiten prophezeien. Aber welche Probleme hören wir, wiedergekäut von Medien, Politik, Demonstranten und Fama, die wieder durch die Straßen fliegt? Dass die Flüchtlinge höhere Sätze bekommen als mancher Rentner zum Leben hat. Dass ja nur Männer kommen. Dass der Wert der eigenen Immobilie sinkt, wenn die benachbarte leerstehende Fabrikhalle zum Übergangsheim eingerichtet wird. Das ist jetzt schon genug wiedergekäut. Vier Mägen hat das Rind. Denn eine Hälfte der Aussagen ist nicht ganz wahr, und die andere Hälfte ist vielleicht doch nicht so relevant? Genau diese Erkenntnis machte sich Anfang November in der Berliner Philharmonie. Schon nach wenigen Takten des Buches mit sieben Siegeln erleben wir den Jüngsten Tag in all seiner Herrlichkeit und Härte. Und als der Herr wiederkam, der König der Könige, bekleidet mit einem Gewande, getränkt mit Blut, als der Herr selbst die Herde der Völker weiden kam mit eisernem Stabe, als der Mord, auch der an den Kindern, niemals ein Ende hatte, als der Chor Tod und Mord und Sturm und Erdbeben pianissimo mit der knappen Zeile So bestraft Gott der Herr die sündige Menschheit kommentiert, als der fünfte und der sechste und schließlich der siebente Engel die Posaune blies: Da lief nicht nur Schauer über viele Rücken. Da wurde bis in die letzten Blöcke klar, wie klein und nichtig unsere Probleme sind vom Weniger-als-vorher und Weniger-wert-als-vorher und vor allem vom Weniger-als-der-andere.
Der aufmerksame Leser wird nun sagen: Schön und gut, aber vor knapp 80 Jahren hat die Uraufführung auch nichts bewirkt, und es ging bergab. Aber Geschichte wiederholt sich nicht. Wohl aber Strukturen und Verhaltensmuster – und die könnte man doch verändern.
Die Strukturen sind schon neu: Gegen die Wiederkäuer hat sich eine merkwürdige Allianz entgegengestellt aus Kultur, Kirche, Wirtschaft und – erstaunlich, aber ganz wunderbar – guter Verwaltung. Damals waren die Stiftungen trotz nicht geringen Vermögens schwach und wehrlos und haben zusehen müssen, wie Geschwister mitten aus der Familie gerissen wurden, jüdische Stiftungen, sozialdemokratisch inspirierte Stiftungen. Heute dürften die Stiftungen ziemlich stark sein, wenn sie zusammenstehen. Schwestern, seid standhaft, heißt es in der Offenbarung. Stiftungen, seid standhaft! Könnte es so nicht auch in der Flüchtlingsfrage lauten? Vielleicht tut es das schon. Denn die Stiftungen haben bereits relativ klar Position bezogen. Bis in kleinste Organisationseinheiten hinein. Die Körber-Stiftung kann – wieder einmal wie so oft, wenn es um best practice und nicht um worst practice geht – als Beispiel dienen. Hier hat der Vorstand beschlossen, dass jeder Mitarbeiter bis zu 20 Prozent der Arbeitszeit für ehrenamtliche Arbeit in selbst gewählten Flüchtlingsprojekten einsetzen kann – unabhängig von der Stiftung, aber in Absprache mit den Vorgesetzen. Denn wer ein Fünftel weniger im Gebäude Kehrwieder 12 oder an den Auenprojekten der Stiftung ist, muss Projekte abgeben oder schlummern lassen. Es sollte zur Abwechslung nicht so sein wie es sonst die Regel ist in vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen (und manchmal sogar in der Wirtschaft): Der Mitarbeiter geht auf 50 Prozent und ist trotzdem geschätzte 80 Prozent vor Ort. Oder eine Projektleiterin bekommt für ihre Tätigkeit nur noch zwei Drittel des bisherigen Lohns, weil ein Drittel aus dem Pflichtenheft entfernt worden sind, die vorher ohnehin nicht zu bewältigen waren. Die Arbeitsmasse bleibt aber die gleiche (weil das andere vorher ohnehin nicht zu bewältigen war – hatte ich das nicht gerade schon geschrieben?). Ja, wenn das Ehrenamt mit der Erwerbsarbeit inhaltlich in so engem Zusammenhang steht. Das tut es bei Körbers nicht: Die Stiftung war schließlich ohnehin seit langem für ihr niedrige Fluktuationsrate bekannt. Ich hatte mir eine Körber-Stiftung ohne die Vorstände Klaus Wehmeier und Michael Wriedt, die vor gar nicht so langer Zeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden waren, gar nicht vorstellen können. Und nun reagiert der neue Vorstand gleich so schön auf eine aktuelle Herausforderung. Gut zu wissen.
Und was sollte das Misstrauen der Stiftungen gegen mögliche Zentralisierungen und fremde Besitzansprüche in den 1930-er Jahren? Wo kommt denn diese Behauptung wieder her? 1934 wandte sich der Leipziger Oberbürgermeister gegen das Ansinnen der neuen Machthaber, allen Stiftungsverwaltungen standardisierte Informationen über die jeweils dort verwalteten Stiftungen abzuverlangen. Ein Kritikpunkt waren unnötige Kosten und unnötige Bürokratisierung – und das auch noch ohne erkennbaren Nutzen für die Stiftungen. Er warnte aber auch vor der Zentralisierung der Stiftungen. Er konnte ja nicht wissen, dass die Nachfolger seines Sohnes einmal 70, 80 Jahre genau das Gegenteil fordern würden …
Oberbürgermeister von Leipzig war 1934 kein Geringerer als der 1945 hingerichtete Widerstandskämpfer Carl Goerdeler. Sein Sohn Reinald war bis in die 1990-er Jahre 1. Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Das ist schon hübsch nicht war? Hatte ich Ihnen in der letzten Kolumne die Besprechung des Neuen Paul Maar-Epigonen-Buches Eine Woche voller Stiftungstage versprochen? Diese Geschichte aus dem wirklichen Leben ist doch viel schöner!
Vorsicht, Stiftung? Vorsicht, Porzellankiste!
Die Kritik am Stiftungswesen ist in Deutschland nicht sehr ausgeprägt. Das kann vier Ursachen haben: 1. Es gibt am Stiftungswesen nichts oder nicht viel zu kritisieren. 2. Was zu kritisieren wäre, ist entweder zu komplex oder zu speziell oder zu uninteressant, als dass sich jemand die Mühe machte zu recherchieren, nachzufragen, zu formulieren, oder vermeintlich zu uninteressant, als dass ein Redakteur das vorschlagen und ein Chef vom Dienst das ins Blatt nehmen würde. 3. Schwarze Schafe gibt es überall; Kritik am Gebaren einzelner Stiftungen würde die ganze Stiftungswelt ins ungünstige Licht setzen. 4. Nichts genaues weiß man nicht. Vorab sei die Auflösung verraten: Nur Ursache 1 trifft nicht zu. Die anderen drei Ursachen stellen im Verbund schon eine so große Hürde dar, dass nur selten ernst zu nehmende kritische Beiträge erscheinen. Damit fallen schon einmal alle „Advertorials“ raus, die die ZEIT Stiftungen gegen Unterstützung schreiben lässt (die Stiftungsverantwortlichen haben dann das Gefühl, sie hätten auch schon einmal in der ZEIT geschrieben, und in Wirklichkeit ist das nur durch Stiftungsgelder finanziert, und die doch sehr schlichten Einlassungen, die ohne wirkliche Recherche mit altem Wissen arbeiten, auf einen dieser Artikel, gefunden in der Online-Ausgabe der FASZ, verweise ich in meinem Blogeintrag vom 25. September 2015 … Darüber wollte ich hier gar nicht schreiben, aber schon ist man mitten in der kritischen Betrachtung. aber weiter im Text). Christian Füllers Beitrag im Freitag ist da anderer Art, ein kluger, sorgfältig recherchierter Text. Der Autor verzweifelt daran, dass auch die Kritiker selten mit Namen genannt werden wollen, dass selten Experten willens sind, für einzelnes Gebaren oder einzelne Missbrauchsfälle von Stiftungen Ross und Reiter zu nennen. Dies vor allem aus Ursache 3. Aber Füllers Gedanken sind absolut lesenswert, gleich, ob man ihm im Wesentlichen zustimmt oder ob man sie für herbeigeredet hält. Ich gehöre zur ersten Gruppe; allerdings stimme ich eben nur im Wesentlichen zu, muss aber an drei Stellen, einmal entschieden, widersprechen; zweimal verlässt sich der Autor dabei auf Zitate von Stiftungsmitarbeitern: 1. Es entsteht der Eindruck, wenn ein Stiftungsgewinn auch dem verbundenen Unternehmen nutzt, sei die Gesellschaft übers Ohr gehauen worden. Nein, man sollte nicht erwarten, dass die Stiftung dem Stifter schadet. Das Gemeinnützigkeitsrecht sieht das jedenfalls nicht vor. Die gestifteten Mittel gehören in der Tat nicht mehr dem Stifter, sondern dem Stiftungszweck. Aber wo die Pervertierung der Stiftungsidee liegen soll, wenn die gestifteten Mittel nicht auch das Ansehen des Stifters mehren dürfen, erschließt sich mir nicht. Dann wären alle Stiftungen pervers. Das kann ich nicht erkennen. Im Gegenteil. 2. Ich bin in gewisser Weise ein Flüchtling. Ein Berliner Republikflüchtling. Meine Anwesenheit an Vortragsabenden, Empfängen und anderen Events hat sich auf vielleicht fünf Gelegenheiten jährlich reduziert, ich fühle mich da nicht angesprochen. Aber den übrigen Menschen, der „Stiftungsschickeria“, vorzuwerfen, sie netzwerkten bei Hummer und Champagner, während kluge Vorträge über Bildungsarmut gehalten würden, ist ungefähr so zielführend wie die immer noch weit verbreitete Ansicht unter Stiftungsgeschäftsführern, man müsse nur belegte Brötchen und Getränke anbieten, dann kämen mehr Journalisten zur Pressekonferenz. Richtig schief wird der Artikel aber dort, wo der Autor das gute Stiftungswesen der USA gegen das schlechte hierzulande ausspielt. Dass die Stiftungen jenseits des Atlantik jedes Jahr fünf Prozent des Vermögens ausgeben müssen, deutsche Stiftungen aber nur aus den Erträgen arbeiten könnten, ist kein Qualitätsmerkmal. Wir können ja mal südamerikanische Demokratien oder wahlweise asiatische Gesellschaften fragen, ob sie froh darüber waren, dass US-amerikanische Stiftungen jährlich fünf Prozent ihres Vermögens ausschütten mussten. Oder vorher Arundhati Roys dreiteiligen Aufsatz in den Blättern für deutsche und internationale Politik lesen (7/2012 bis 9/2012, vor allem „Der Imperialismus der Wohltäter“ in der Nummer 8/2012). Oder um nicht aufs Gestern, sondern aufs Heute zu schauen, empfehle ich Kathrin Hartmanns neues Buch Aus kontrolliertem Raubbau, in dem der Leser Aufschlussreiches über die Gates-Stiftung erfährt. Mir persönlich sind die Projekte der Stiftungen in Deutschland im Vergleich dazu ausgesprochen sympathisch. Aber kritikbedürftig sind sie natürlich dennoch. Insofern ein Dank an Christian Füller für einen seltenen wichtigen Diskussionsbeitrag zum Stiftungsdiskurs.
Den typischen Stifter gibt es (immer noch) nicht
Die aktuelle StiftungsWelt, die Verbandszeitschrift des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, legt den Schwerpunkt auf die „Wegweiser“, auf Stifterinnen und Stifter in der Stiftung und stellt eine neue Stifterstudie vor, die die Motive der Stifter in Deutschland untersucht hat. Es ist die erste große Folgeuntersuchung nach der Stifterstudie Stiften in Deutschland, die 2005 der damals bei der Bertelsmann Stiftung beschäftigte Karsten Timmer betreut hatte. Bei allen Verschiebungen im Detail lässt sich sagen, dass die neue Studie keine atemberaubende neue Information bereit hält. Auch der Kernsatz ist exakt der gleiche geblieben: „Den typischen Stifter gibt es nicht“ ist schon die Überschrift über dem ersten Teil einer Artikelserie in der Frankfurter Rundschau vom Sommer 2004. Davon später mehr. Auch der Auftaktartikel selbst beginnt mit diesem Satz. Und die Stifterstudie 2005 beginnt ein Jahr später identisch mit dem Satz „Den typischen Stifter gibt es nicht.“ Erster Satz nach der Einleitung der neuen Stiftungsstudie Stifterinnen und Stifter in Deutschland: „Den typischen Stifter gibt es in der Realität natürlich nicht.“ Da ist außer einem „in der Realität“ und einem „natürlich“ nicht viel Neues dabei.
Auch in der Öffentlichkeitsarbeit hat sich, was den Umgang mit dem Stifter nicht viel geändert. Immer noch dienen die gleichen Wohltäter als leuchtende Beispiele, wenn es darum geht, wie eine Stiftung vom Renommee ihres Stifters profitieren kann. Und immer noch befinden sich die guten Stifter nicht in der besten Gesellschaft, auch wenn man schaut, wer sich da zuweilen als Stifter präsentiert. Kaum ein anderes Beispiel verdeutlicht dies so wie die Geschichte eines stern-Artikels aus dem Jahr 2000. Es geht nicht um die Hitler-Tagebücher, das liegt weiter zurück.
Die stern-Botschaft war zweifellos positiv: In der Ausgabe des Hamburger Wochenmagazins vom 12. Oktober 2000 lachten dem Leser viele fröhliche Gesichter durch Goldrahmen entgegen. Ein Satz als Bildunterschrift und schließlich der Artikel selbst auf immerhin vier Seiten verrieten die Gemeinsamkeit der Einzelporträts, die so gar nicht in Öl oder Kupferstich daherkamen, wie es der Goldrahmen vermuten ließ. Die hier geehrten Personen schienen im Gegenteil recht lebendig, als würden sie gleich aus dem Rahmen springen oder doch wenigstens gleich würdevoll dahinter hervortreten. Es waren allesamt Stifterinnen und Stifter, die erst vor kurzer Zeit ihre Stiftung errichtet hatten und nun erste Erfolge des stifterischen Engagements noch miterlebten.
Anlass des Berichts im stern war die größte Rechtsreform für Stiftungen seit Bestehen der Bundesrepublik. Die rot-grüne Regierung wollte die Rahmenbedingungen für Stiftungen so weit verbessern und die Anerkennung von Stiftungen (die damals noch Genehmigung hieß) so weit erleichtern, dass auch Personen mittleren Einkommens die Rechtsform Stiftung als eine Form bürgerlichen Engagements ansah, die für sie eine Alternative zur Spende darstellt. Die Reform galt zunächst dem Stiftungssteuerrecht, und erstmals galten für die Zuwendungen ins Stiftungskapital Abzugsmöglichkeiten, von denen andere gemeinnützige Organisationen nur träumen konnte.
Der stern-Atikel war der erste, der ausnahmslos relativ unbekannte Stifter in den Fokus rückte und damit dem Geist des Gesetzes Rechnung trug. Brigitte Zander, die Autorin, hatte sich davor im Bundesverband Deutscher Stiftungen ein paar passende Kandidaten nennen lassen, die die Nummer mit dem Goldrahmen auf sich nahmen – zum Wohl der Stiftung und ihres Stiftungszwecks. Als Jünster war der 55-jährige Michael Succow, als Älteste die 85-jährige Ilsetraut Glock-Grabe dabei. Der Hochschulprofssor aus Greifswald hatte 1997 den Alternativen Nobelpreis gewonnen und mit dem Preisgeld die Michael-Succow-Stiftung zum Schutz der Natur errichtet. Die Bonner Grafik-Künstlerin gab den größten Teil ihrer Kunstsammlung und des eigenen Œuvres in die neu errichtete Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung als unselbstständige Stiftung in kommunaler Trägerschaft ihrer Geburtsstadt Nordhausen. So unterschiedlich Anliegen, Ort, Größe und Rechtsform auch sein mochten, es sollten Stifter sein, die der Stiftungsarbeit zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen könnten.
Glaubwürdigkeit war schon im Jahr 2000, als der stern-Artikel erschien, ein hohes Gut. „Wenn ein Projekt glaubwürdig ist, dann öffnen sich auch die Herzen,“ hatte Michael Succow beobachtet. Schon früher hatten Stifter ein gesellschaftliches Ansehen ähnlichen Ranges wie der Familienunternehmer, der Handwerker, der Lehrer, der Pfarrer. All diese Stützen der Gesellschaft waren Vorbilder. Der Familienunternehmer ist hinter die Herren in immer denselben grauen oder dunkelblauen Zweireihern getreten, der goldene Boden, den das Handwerk einmal hatte, ist verschwunden und taucht heute als Mastercard Gold oder goldene Kundenkarte wieder auf. Geschlossene Kirchen und zusammengelegte Gemeinden künden vom Rückgang der Priesterweihen, und Lehrer haben heute vor Konferenzen und Konfliktlotsengesprächen überhaupt keine Zeit mehr, als Vorbilder in Erscheinung zu treten. Wirklich geblieben sind als Vorbilder beinahe nur noch die Stifter – mit anderen Helden des Alltags aus der Zivilgesellschaft.
Neue Stifter in alten Rahmen, der Ansatz der Journalistin: nicht falsch, nicht einmal weit hergeholt. Auch vor 15 Jahren lag der Anteil der Menschen, die schon zu Lebzeiten eine Stiftung errichten, über dem der Stiftungen von Todes wegen. Und der Stifter kennt schließlich seinen Stiftungszweck am besten und kann Spannendes dazu berichten. Doch wer sich zu eng an den Stifter bindet, läuft Gefahr, ihn nicht mehr loszuwerden. Entsprechendes gilt für die Öffentlichkeitsarbeit, wenn sie ihre Stifter als Botschafter für die eigene Stiftung einsetzt. Auch beliebte Stifter, große Persönlichkeiten, echte Wohltäter sind keine Götter. Erstaunlich eigentlich, dass das noch betont werden muss. Seit dem Tod Berthold Beitz’ wird diese Feststellung immerhin nicht mehr mit Ächtung bestraft. Wenn Stifter und Stiftungsrat unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie die Stiftung den Zweck am besten erfüllt, kann es am Ende durchaus sein, dass der Stifter den Kürzeren zieht. Denn die Stiftung gehört dem Stiftungszweck, nicht dem Stifterwillen. Wenn aber der Eindruck entsteht, hier sei der Stifter respektlos oder undankbar behandelt worden, wenn plötzlich Begriffe wie „Hausverbot“ und „Rauswurf“ im Raum stehen, regt das potenzielle Stifter nicht gerade zur Nachahmung an. So gesehen – die Verbandszeitschrift nennt nachvollziehbarerweise keine Negativbeispiele. Aber zur goldenen Seite des Stiftens gehört immer auch die dunkle Seite der Macht. Das mag Management oder den Stifter betreffen. Die Pankower Allgemeine Zeitung titelte am 15. Februar 2014 online „Gründer der Björn-Schulz-Stiftung abgesetzt“, beim Tagesspiegel heißt es am 20. Februar 2014 „Der Gründer muss gehen“. Es gab, so war zu lesen, unterschiedliche Vorstellungen bei der Erweiterung des Vorstandes weg vom bisherigen Alleinevorstand, den der Stifter seit Errichtung der Stiftung 18 Jahre zuvor bildete. Ganz egal, was da im Einzelnen vorgefallen war: Dem Stiftungswesen hat das Schaden zugefügt, denn ein fahler bitterer Beigeschmack bleibt.
Diese vorsichtige Warnung vor allzu großer Einflussnahme des Stifters gilt für jene Stiftungen, die schon in hauptamtlichen Strukturen arbeiten. Für die vielen kleinen Stiftungen ist die Präsenz der Stifter gerade auch in der Kommunikation unverzichtbar. Die Norbert Janssen Stiftung in München etwa ist auf ehrenamtlichen Einsatz angewiesen. Der kommt aus vielen Richtungen, vor allem aber – auch bei der Kommunikation – vom unermüdlichen Stifter und Namensgeber selbst.
Norbert Janssen ist der bescheidene, ruhige Typ Stifter, der gleichwohl Feuer und Flamme für den Zweck seiner Stiftung ist: Talente fördern, auch jenseits der Universität, auch unabhängig vom Leistungs- und Elitedenken. Die Vielfalt im Stiftungswesen zeigt sich auch im Temperament der Stifter bei der Öffentlichkeitsarbeit der Stiftungen. Da ist, man verzeihe den Ausflug in die Fauna, vom scheuen Reh im Streichelzoo bis zur Rampensau alles vertreten (das ist bei den dem Stifter nachfolgenden Stiftungsmanager übrigens nicht anders). Unabhängig davon, ob eine Stifterin die Menge scheut oder sucht: Die Stiftung sollte zu Lebzeiten Ton- und Bilddokumente über den Stifter archivieren. Sonst ist es dafür irgendwann zu spät.
„Den typischen Stifter gibt es nicht“, war der erste von 14 Teilen einer Artikelserie überschrieben, die ab 18. August 2004 wöchentlich in der Frankfurter Rundschau über die Grundlagen des Stiftungswesens in Deutschland informierte. Keine andere Zeitung hatte bislang in diesem Umfang in einer Serie das Stiftungswesen beschrieben. Brömmling hatte die Serie in der Redaktion angeregt und war auch Autor aller Beiträge. Gleich in der dritten Folge lernten die Leser, dass die Gleichung Stifter = konservativ nicht aufgeht. Ein Buch über Stifterinnen (2010), ein weiteres über Mäzeninnen (2014) lassen den Verdacht aufkommen, dass Stiften auch weiblich sei und werden könnte. Bereits die Stifterstudie der Bertelsmann Stiftung arbeitete 2005 heraus, dass sich die Stifter gegen Typisierungen wehrten. Sie lassen sich nicht klassifizieren. Der typische Stifter in der breiten Öffentlichkeit – da ist also „typisch“ genauso wenig wert wie „breit“. Jede Stiftung, die mit ihrem Stifter in die Öffentlichkeit will, muss bei der Planung heute damit rechnen, dass ihr Stifter links, lebend und eine Frau sein könnte. Aber das ist nicht mit der Kehrseite gemeint.
Leider hält das Leben nicht nur Kalauer bereit. Das zeigte auch der stern-Artikel über Stifter im Goldrahmen. Die stern-Journalistin meldete sich telefonisch eine knappe Woche nach Erscheinen. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, für die Kontaktvermittlung zu den Stiftern. Sie habe da allerdings auch einen Hinweis erhalten, vom Anwalt der erwachsenen Kinder eines der Stifter. Die traumatisierten Kinder seien vom Vater vernachlässigt worden und ohne Liebe aufgewachsen. Der hätte sich lieber um seine Stiftung gekümmert. Da sei die Ehrung durch eine Stiftergalerie eher kontraproduktiv.
Aber neben bekannten und unbekannten Lichtgestalten des Stiftungswesens wie Michael Succow und Ilsetraut Glock gibt es eben auch die anderen. Es kann und soll nicht darum gehen, die Stifter einem Generalverdacht auszusetzen. Es hilft einfach, auf dem Teppich zu bleiben. Denn auch das Stiftungswesen ist nur ein Teil dieser Gesellschaft.
[Hinweis: Bei dem Text handelt es sich um eine Kolumne, die regelmäßig in den Nachlieferungen des Loseblattwerkes „StiftungsManager“ erscheint. Im Blog wird ab 2015 die Kolumne veröffentlicht, sobald eine Nachlieferung die jeweils nächste, neue Kolumne gedruckt hat. So bleibt der aktuellste Text den Abonnenten des Verlages Dashöfer vorbehalten, und der nächstjüngste Text lädt hier gleichzeitig dazu ein, selbst Abonnent zu werden. Ihr Ansprechpartner im Verlag ist Mark Jacobs. Die nachstehende Kolumne erschien in der Nachlieferung 43 im August 2015.]
Ein Vierteljahrhundert ist Deutschland nun schon wieder einig Stifterland. Wir schauen mal darüber hinweg (auch wenn das einem Kolumnisten wirklich schwerfällt), dass es erst einige Jahre gedauert hatte, bis die Stiftungen merkten, dass die Mauer gefallen war und man vielleicht auch etwas für die Stiftungsbrüder und Stiftungsschwestern erst in der Noch-DDR, dann in Neufünfland tun könnte. Als man dann endlich wach geworden war, war es für diverse Altstiftungen, die der Restitution harrten, schon zu spät. Aber ein paar ganz große Dinge bekam man dann doch auf die Reihe, und jeder kann 25 Jahre nach der Wiedervereinigung von Ost und West auf gelungene Projekte (an-)stoßen, die es ohne die Stiftungen heute nicht oder nicht mehr geben würde. Die restaurierten Orgeln in Mecklenburg-Vorpommern (ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius), die Bürgerstiftung Dresden (Körber-Stiftung), die Franckeschen Stiftungen zu Halle (in Halle halfen alle), die Anna Amalia Bibliothek (Vodafone Stiftung) und die Georgenkirche in Wismar (Deutsche Stiftung Denkmalschutz). Man macht sich sicher keine Freunde (zumindest nicht unter denen, die Glossen nur flüchtig lesen), wenn man darauf hinweist, was alles nicht mehr da ist – trotz oder gerade wegen des Einsatzes aus dem Westen. Der Palast der Republik mit der modernsten Bühnentechnik der Welt – selbst zu Wendezeiten war das nicht zu verachten –; fragt man ehemalige DDR-Bürger, war das tatsächlich ihr Palast. Da half keine Stiftung. Im Tresor kann man nicht mehr tanzen, im Gastmahl des Meeres nicht mehr speisen, Dresden hat einen UNESCO-Welterbetitel verloren, und die Kreidefelsen auf Rügen rutschen auch einer nach dem anderen ins Meer. Gegen Investoren, Dummheit und Naturgewalten kämpfen auch Stiftungen vergebens.
Doch wiegen wir uns nicht in Sicherheit oder seien wir nicht enttäuscht: Wer in den letzten 25 Jahren keine Gelegenheit hatte, etwas kaputtzumachen, kann dies gerne noch nachholen. So dürfte sich eine Sammelschussanlage, die die Bundeswehr ab 2017 nördlich von Potsdam einrichten will, als erstes Opfer ein teures Stiftungsprojekt aussuchen. „Zehn Jahre Naturschutzarbeit und 13 Millionen Euro Spendengelder“ würden jedenfalls vernichtet, wenn es tatsächlich zum Bau der Sammelschussanlage kommt, klagt die Heinz Sielmann Stiftung. Hoffentlich klagt sie auch richtig. Es gibt Gerichte.
Gerüchte gibt es auch. Es hätte alles so schön sein können. „München leuchtete“, so beginnt Thomas Mann seine Erzählung Gladius Dei. Jetzt blitzt es höchstens hin und wieder auf – in den Stiftungsschlagzeilen. Die Stiftungen selbst, die Stifter zumal, können meist nichts dafür, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende und der kaufmännische Geschäftsführer der angehängten GmbH gemeinsame Sache machen. Die GmbH ist gemeinnützig und die Rede ist in der Süddeutschen Zeitung vom 13. Juni 2015 immerhin von einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Die finden sich sicher wieder an: Schließlich ist der Heilige Augustinus der Schutzpatron auch derer, die etwas verloren oder verbummelt haben. Aufrichtig und anständig zu arbeiten, ist immer eine gute Alternative zum veruntreuen und verbummeln. „Schwere Arbeit hat noch niemandem geschadet. – Gewiss, aber Nichtstun verursacht die wenigsten Unfälle.“ Wieder so ein Spruch aus der Trierer Spruchkartensammlung. Das Stiftungswesen lehrt einen, dass auch das apokryphe Buch der Trierer Sprüche Unrecht haben kann. Schließlich kann man Fördergelder nur ausschütten, wenn man sie zuvor generiert. Doch wo Immobilien nicht vermietet sind, kommt keine Miete rein. Auch hier hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, zum ersten Mal sogar im November 2013. Kaum ist der Münchner Stiftungsfrühling vorbei, kommt offenbar der Herbst. Das erinnert doch ein bisschen an den Prager Frühling. Woran denken Sie, wenn Sie „Prager Frühling“ hören? An 1968, genau. Der Prager Frühling ist aber auch, ich weiß nicht genau, wer da so minderfeinfühlig in der Prager Stadtverwaltung war, ein jährliches Festival im Mai. Ich habe dort selbst mal mit einem Göttinger Chor die Lobgesang-Sinfonie gesungen – und kann nun stolz erzählen, dass ich, Jahrgang 1969, am Prager Frühling teilgenommen hätte. Nicht überall, wo Frühling draufsteht, ist auch Frühling drin.
Manchmal muss ein Stiftung Fördergelder auch zurückgeben, in einem Fall waren es 1,8 Millionen Euro, die der Bund zurückforderte. Eine andere Stiftung lädt eine rechtskonservative AfD-Politikerin in den Landtag ein. So weit herrscht noch Meinungsfreiheit in Deutschland, und die Stiftungen haben diese empfindliche Pflanze geschützt, wo immer es ging. Schutz der Pflanzen, Schutz der Tiere, Schutz der Vielfalt. Aber auch ein Tierschützer würde einen Elefanten nicht ohne Not über ein Feld schicken, wo gerade seltene Gewächse keimen.
Das alles hat München nicht verdient. Die meisten Stiftungen arbeiten höchst ehrenvoll und sind oft sogar ehrenamtlich geführt. Und Skandale gibt es schließlich auch woanders. In Köln und Berlin zum Beispiel besonders dreist die BWF-Stiftung (vom Bund Deutscher Treuhandstiftungen e. V.). Da überrascht die Berliner Stiftung damit, dass sie gar keine Rechtspersönlichkeit hat; eine unselbstständige Stiftung, sieh mal an. Vielleicht ist das endlich mal ein Anlass zur Offenlegungspflicht der Finanzbehörden über die gemeinnützigen Institutionen, die in der jeweiligen Behörde geführt wird. Oder ein Treuhandregister. Da hätte man zumindest leicht sehen können, ob die Stiftung gemeinnützig sein und wer Treuhänder, wer Stifter sei. Zum Skandal sei jetzt nur kurz Rechtsanwalt Nikolaus Sochurek zitiert, der davon ausgeht, dass die eigentlich Verantwortlichen für den BWF-Skandal auf der Management-Ebene zu finden seien, aber dann muss auch Schluss sein mit dem Finger-in-die-Wunden-Legen … Sochurek arbeitet in München. Ein guter Abschluss also.
Während hierzulande manch einer gemeinnützigen Umweltstiftung das Leben schwer gemacht wird, nehmen andernorts Natur- und Tierschutzstiftungen die Arbeit auf. Wir sprechen nicht von der Nature und Wildlife-Foundation in Vaduz, die wohl unter anderem einen pensionierten Oberfinanzpräsidenten in Deutschland gefördert hat – welches wilde Leben da auch immer geschützt werden sollte. Ich denke da eher an eine wirklich gemeinnützige Stiftung. Prinz Charles hat jetzt eine solche Stiftung in Transsylvanien errichtet. Lesen Sie es ruhig noch einmal laut und spitzen Sie die Ohren. Richtig gehört! Wenn es auch nicht in erster Linie um den Schutz von Vampiren geht – um den Schutz von Fledermäusen geht es allemal. Man hat das ja manchmal mit den Hunden und ihren Haltern: Sind sie lange genug zusammen, meint man eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. Vielleicht gilt diese Ähnlichkeit auch für Stifter und ihren Stiftungszweck? Die Fledermäuse mit ihren riesigen Ohren jedenfalls – das kann kein Zufall sein. Vielleicht lassen sich so auch Zustifter leichter finden.
Zustifter müssen allerorten aber erst noch ermuntert sein, auf eine eigene Stiftung zu verzichten. Die meisten reizt die eigene Stiftung zu sehr. So verwundert es nicht, dass die Familie von Tugce Albayrak eine neue Stiftung errichten will – für Zivilcourage, vor allem aber zur Erinnerung an Tugce. Die Stiftung soll jedes Jahr einen Preis für Zivilcourage vergeben. Dem Verein zur Sammlung von Stiftungskapital hat das Finanzamt bereits die Gemeinnützigkeit bescheinigt. Vorläufig für drei Jahre, wie wir wissen. In den Medien steht das natürlich nicht. Die Dominik-Brunner-Stiftung hat auf den Fall Tugce hingewiesen. Sie erinnern sich? Dominik Brunner wurde auch seine eigene Zivilcourage zum Verhängnis, als er in München-Solln bei einem Streit dazwischenging. München ist jetzt aber wirklich nur Zufall, nur der bekannteste. Auch die Dominik-Brunner-Stiftung vergibt Auszeichnungen für Zivilcourage. Und einen Tugce-Albayrak-Preis soll es nun auch geben. Dass mehr Zivilcourage nötig ist, ist keine Frage. Es sollte zur Selbstverständlichkeit werden. Aber muss es eine eigene Stiftung sein? Eigentlich hätte man doch auch der jeweiligen Bürgerstiftung zustiften können – für einen Zivilcourage-Preis. Oder bestehende Vereine unterstützen. Vereine und Stiftungen, die sich für Zivilcourage einsetzen, die im Netz, an Schulen, auf der Straße Aufklärungsarbeit betreiben und Menschen einladen, sich zu engagieren, gibt es schon. „I am Jonny“, gegründet von der Schwester des 20-Jährigen, der 2012 am Berliner Alexanderplatz totgeprügelt wurde. Und die Amadeu Antonio Stiftung, die an den 1990 von Neonazis ermordeten Amadeu Antonio Kiowa erinnert, ist groß und schlagkräftig. Größer und schlagkräftiger kann sie ruhig werden. Manchmal machen auch die öffentlichen Stellen etwas richtig, muss man zugeben, wenn man auf die Seite von „aktion-tu-was.de“ geht – einer Initiative der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes geht.
Aber manche Stiftungsgründung ist unabhängig von der Größe zu begrüßen. Denn sie mag ganz außergewöhnliche Geschenke und Zuwendungen bekommen, die andere vielleicht nicht erhalten. Der durchaus förderungswürdigen Bertha-von-Suttner-Stiftung jedenfalls, die sich im Rahmen ihres Engagements für Frieden auch für mehr Zivilcourage engagiert, schenkten entweder der liebe Gott oder die griechische Friedensgöttin Irene einen Tag mehr im Jahr. Über Anträge, die bis 31.7. vorliegen, so verspricht die Stiftung auf ihrer Homepage, gibt es eine „Entscheidung bis 31.9.“ Vielleicht machen wir lieber den 31.9. zum „Tag der Stiftungen“. Das ist – natürlich nur rein rechnerisch – der 1. Oktober, den erst die Bürgerstiftungen, dann alle Stiftungen tatsächlich zu ihrem Tag erklärt haben. Erich Kästner, schon früh in seinen Romanen Zivilcourage beschreibend, hatte die Idee schon mal so ähnlich. Der veröffentlichte sein Kinderbuch Der 35. Mai im Jahr 1931. Und was in Paul Maars Eine Woche voller Stiftungstage passiert, erfahren Sie in der nächsten Kolumne.
Stiftungen mit Herz, aber ohne Kartell
[Hinweis: Bei dem Text handelt es sich um eine Kolumne, die regelmäßig in den Nachlieferungen des Loseblattwerkes „StiftungsManager“ erscheint. Im Blog wird ab 2015 die Kolumne veröffentlicht, sobald eine Nachlieferung die jeweils nächste, neue Kolumne gedruckt hat. So bleibt der aktuellste Text den Abonnenten des Verlages Dashöfer vorbehalten, und der nächstjüngste Text lädt hier gleichzeitig dazu ein, selbst Abonnent zu werden. Ihr Ansprechpartner im Verlag ist Mark Jacobs. Die nachstehende Kolumne erschien in der Nachlieferung 42 im Mai 2015.]
Es soll keine Essaysammlung werden, was Sie hier Nachlieferung auf Nachlieferung lesen können. Der letzte Text war der Frage gewidmet, was Satire im Stiftungswesen darf. Mühelos ließe sich heute darüber sinnieren, ob Fluch und Fäkal und Foundation zusammenpassen. Sie können beruhigt weiterlesen, auch in diesem Text wird es wie stets gesittet zugehen. Kein Fluch, nirgends. Auch wenn man verleitet war, bei der jüngsten großen Stiftungsgründung die Redensart vom Teufel und dem größten Haufen zu zitieren.
Es ist erst ein Jahrzehnt her, dass ein einzelner Stifter den Stiftungsstatistikern und Datensammlern die Nutzlosigkeit ihres Tuns vor Augen hielt. Genau genommen war es die Witwe des Stifters. Die Errichtung einer Stiftung war testamentarischer Wille von Joachim Herz, dem Tchibo-Mann. Zu Lebzeiten der neuen Generation von Stiftungsmanagern trat zum ersten Mal eine natürliche Person als Stifter eines zehnstelligen Euro-Vermögens auf den Plan. Die Nutzlosigkeit des Datensammelns der Statistiker rührte weniger vom Namen als von der Verhältnismäßigkeit her: Was bringen Angaben zur Höhe des im Vorjahr gestifteten Vermögens, wenn die Zahlen jegliche Aussagekraft verlieren, weil ein einzelner Stifter in seine neue Stiftung etwa so viel Stiftungsvermögen einbringt wie alle anderen in alle übrigen neuen Stiftungen zusammen?
Ein anderes, in der Stiftungsszene bislang weitgehend unbekanntes Problem hätte man bei der Errichtung der Joachim Herz Stiftung nur bei äußerster Spitzfindigkeit ausmachen können. Nach der 1979 gegründeten Deutschen Herzstiftung e. V. in Frankfurt am Main und der Heinrich Hertz-Stiftung aus dem Jahr 1961 mit Sitz in Düsseldorf nahm die Max und Ingeburg Herz Stiftung bereits 1979 in Hamburg ihre Arbeit auf. Es folgten die Herz HD Stiftung in Heidelberg von 1998, die Münchner Herz für Herz – Stiftung für Leben! von 2003 und die Stiftung Herz und Seele von 2005 in Uelzen. Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (Berlin kleckerte dann 2013 mit der Stiftung Herz Jesu Berlin-Charlottenburg hinterher) hatten also alle ihre ganz besondere Herz-Stiftung, als im Jahr 2008 noch eine Herz-Stiftung in Hamburg dazukam. Das, dachte man, sollte eigentlich kein Problem sein. Ein Stifterherz hatte in Hamburg aufgehört zu schlagen, eine Herzstiftung nahm in Hamburg die Arbeit auf.
Milliardenschwer war die Joachim Herz Stiftung, die da mit Umsicht und Bedacht zunächst ein paar Jahre sondierte, wie sie sich am besten positionieren könnte, bevor sie nennenswerte Förderbeträge ausschüttete. Sie wollte dem Stifterwillen so sinnvoll wie möglich erfüllen. Ein großer Teil der Fördergelder wird Menschen zu Gute kommen, die in Hamburg leben, wie sich auch an den ersten Förderungen zeigt: Beim Projekt heimspiel. Für Bildung engagiert sich die Joachim Herz Stiftung zusammen mit der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. in den Hamburger Quartieren Wandsbek Hohenhorst und Harburg Neuwiedenthal/Hausbruch für bessere Bildungschancen. PIER – Partnership for Innovation, Education and Research soll als strategische Partnerschaft zwischen der Uni Hamburg und DESY die Forschung stärken, und die Beteiligung der Joachim Herz Stiftung am MINTforum Hamburg fördert die Begeisterung Hamburger Schüler für die Naturwissenschaften und Technik.
Das sind viele Kooperationen, wie es guter moderner Brauch ist unter Stiftungen, und gegen keines der Projekte lässt sich Substanzielles als Kritik anführen. Schließlich haben vier der in der Stiftungsszene bekanntesten Stiftungen ebenfalls in Hamburg ihren Sitz: Die Körber-Stiftung, die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, die schon erwähnte Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., die Hermann Reemtsma Stiftung. Und eine große Zahl der Projekte aller dieser Stiftungen sind auf Hamburg beschränkt. Die milliardenschwere Joachim Herz Stiftung hält es kaum anders. Und jetzt kommt Michael Otto. Eine geradlinige Haltung zeigte sich mehrmals bei der PR-Arbeit des Otto Konzerns, Haltung bewies stets auch Werner Otto, der Vater des Stifters einer der größten Stiftungen überhaupt Viele Milliarden wert ist die neue Stiftung, in die Michael Otto nun seine Anteile an der Unternehmensgruppe gegeben wird. Dass der Stiftungs- und Firmensitz unveränderbar auf Ewigkeit Hamburg sein wird, zeugt vom Dank des Stifters an seine Heimatstadt. Kinder und Jugendliche stehen im Fokus der Stiftungsarbeit. Es steht nur zu hoffen, dass ein guter Teil jener dreistelligen Millionenbeträge, auf die man die Stiftungserträge in guten Jahren schätzt, auch Kindern und Jugendlichen zu Gute kommt, deren Eltern es nicht vergönnt war, in Hamburg zu leben. Kein Stiftungsneid, der Hansestadt und ihren Bewohnern sei das Stiftungsglück herzlich gegönnt. Aber Stiftungskälte und Ausgrenzung eben auch nicht. Es wird spannend, wie es hier weitergehen wird und wie die Öffentlichkeit die neue Riesenstiftung annehmen und begleiten wird.
Doch ist nicht alle Mühe der Kommunikation auf allen Ebenen vergebens, wenn die Journaille wider besseren Wissens nach altem Muster strickt? Im April berichtete die Online-Ausgabe der, sagen wir mal, Allgemeinen Leib- und Magen-Tageszeitung des hehren Stiftungswesens über Stipendienstiftungen. Die Lektüre trieb einen aus dem Haus und ließ einen unabhängig vom Wetter freiwillig dem Osterspaziergang vom Vortag noch den Emmaus-Spaziergang hinzufügen. Den Beginn des Berichtes kann man noch als ungeschickt bezeichnen. Da wird der Idealkandidat eines Stipendiaten von Stiftungen quasi als Eier legende Wollmilchsau bezeichnet. Fast ein Ding der Unmöglichkeit, was die Stiftungen da alles fordern, will der Text glauben machen. Mal ganz abgesehen davon, dass es jetzt nicht gerade um ein Zeichen besonderer Vielseitigkeit handelt, wenn sich ein Architekturstudent auch für Mathematik interessiert – und abgesehen davon, dass keine Stiftung, wirklich keine, es als einen Pluspunkt bei der Bewertung zählt, wenn ein Bewerber „vormittags im Hörsaal sitzt“ und „fleißig mitschreibt, was der Professor vorträgt“: Ist es wirklich so undenkbar und weltfremd, dass ein junger Mensch aus Kursen und Klausuren „Bestnoten nach Hause trägt“ und dass dieselbe Person zwei Hobbys hat, von denen eines eine ehrenamtliche Tätigkeit darstellt?
Solche außergewöhnlichen Kreaturen reüssieren, das ist die gute, brandneue Nachricht des Berichtes, erfreulicherweise nur bei einem kleinen Häuflein Stipendiengeber. Nun handelt es sich bei dieser einen beschriebenen Gruppe Stiftungen nicht, wie der Artikel glauben machen will, um „die sogenannten zwölf Begabtenförderungswerke“. Wäre das Wort von den „zwölf Begabtenförderungswerken“ so geläufig, so eingängig ins Ohr und leicht von der Zunge gehend, hätte irgendein Lästerer längst FES, KAS & Co „das dreckige Dutzend“ getauft. Vermutlich sollte die Rede sein von den „zwölf so genannten Begabtenförderungswerken“. Aber das ist etwas anderes. Kunstfertig ist der Artikel allerdings dann doch. Obgleich er die übrigen Stipendienstiftungen von den Begabtenförderungswerken abgrenzt, gelingt es in bemerkenswerter Weise, beide Gruppen gleichermaßen schlecht zu machen. Stellen die Förderungswerke absurde, unerreichbare Streberanforderungen, freuen sich die anderen quasi auch über die Faulen und Dummen, die ansonsten auf das eingeschränkte Förderprofil passen: da müsse einer nur aus der ehemaligen Grafschaft Henneberg kommen und schon winke ihm ein Stipendium. „’Nur’ ist gut“, mag da mancher Henneberger denken. In der Tat vergessen wir manchmal, dass auch ein Geburtsort ein Schicksal sein kann wie man von Vornamen zuweilen sagt, sie seien eine Diagnose, Kevin etwa oder Mandy. Im kritisierten, wir können auch sagen verrissenen Artikel erhalten alle Stiftungen den Ruch des Skurrilen. Dass sich an diesem Artikel zum Schluss noch zeigt, auf welche Datengrundlage Journalisten ihre Berichte stützen, soll an anderer Stelle einmal bewiesen werden. Jede fünfte Stiftung wird ihr Geld nicht los? Das galt vielleicht mal 2003. Heute sieht es anders aus.
Nun kann man über so einen Artikel hinwegsehen und hinweggehen, in welchem Medium auch immer er erscheint. Aber gerade jene, die mit Stiftern zu tun hatten oder haben, die also gelernt haben, dass die Welt sich aus mehr zusammensetzt als aus Kennzahlen, Konten und Krediten, sollten ihre Fähigkeit nicht aufgeben, Misstöne zu vernehmen und zwischen den Zeilen zu lesen. Was weiterhin zählen sollte, ist nicht die Marktkonformität des Stifters, sondern sein Anliegen und sein Motiv. Bei manchen kann das gut zusammen gehen, bei Michael Otto etwa, und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt unserer Frühlingskolumne angelangt.
Standing Ovations für Jenny de la Torre
Manchmal ist es die geehrte Persönlichkeit, die der ehrenden Organisation eine ganze Veranstaltung noch zum Gelingen bringt. Jenny de la Torre ist so ein Fall. Dass der Deutsche Stiftungstag 2015 in Karlsruhe in allerbester Erinnerung bleiben wird, ist vor allem der engagierten Ärztin aus Peru zu verdanken, die am Freitag den Deutschen Stifterpreis 2015 erhielt. Jenny de la Torre engagiert sich seit 20 Jahren in Berlin als Ärztin für Obdachlose. Sie hat mit einem kleinen Preisgeld für die Goldene Henne, mit nur 25.000, vor Jahren eine Stiftung errichtet und mit unermüdlichem Engagement inzwischen ein Gesundheitszentrum in der Pflugstraße in Berlin-Mitte aufgebaut. Die kleine Frau, Jahrgang 1954, hatte die Herzen der ganzen Festversammlung schon für sich gewonnen, da hatte sie noch kein einziges Wort gesagt. Eine gelungene Laudatio von Michael Göring mag ein Übriges getan haben: Jedenfalls erhoben sich die Anwesenden im Konzertsaal am Freitagvormittag von ihren Plätzen und spendeten minutenlangen Beifall. Der Deutsche Stifterpreis ist ein ideeller, undotierter Preis. Preisträger wie der kürzlich verstorbene Klaus Tschira (1999) hätten das vermutlich in der Tat nicht benötigt; Allerdings hätten sich sicher auch Eske Nannen (2000) und Paul Raabe (2001) über zusätzliches Geld fr ihre Projekte gefreut, seien es die Kunsthalle Emden oder die Franckeschen Stiftungen zu Halle. Aber jetzt wird für die Pflugstraße in Berlin gesammelt. Bleibt zu hoffen, dass viele es der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius gleichtun und selbst die Arbeit von Jenny de la Torre unterstützen. Gerne mit 10.000 Euro wie die ZEIT-Stiftung, die hab ich gerade nicht zur Verfügung, aber spenden werde ich auch. Jenny de la Torre ist mir nicht unbekannt: Ich habe sie für die StiftungsWelt 2-2010 interviewt: Mein aktuelles Porträt der Preisträgerin wird es in der Sommerausgabe von VIERVIERTELKULT geben.
Ciao Feingefühl!
Muss man denn immer auf die Schwachstellen hinweisen, wenn das große Ganze stimmt? „Wo aber bleibt das Positive?“ Hat Erich Kästner mal gefragt. Was gerne übersehen wird, wenn Kästner bemüht wird: Kästner hat den Bundesverband Deutscher Stiftungen nicht gekannt. Und er hat keineswegs gemeint, dass man das Negative nicht erwähnen dürfe. Der Deutsche Stiftungstag hatte jedenfalls noch ganz gute Chancen für einen guten Auftakt. Der Oberbürgermeister hatte zwar ein Manuskript, aber sprach doch völlig frei und sehr gut. Und Agnieszka von Zanthier war angekündigt, über den Kreisauer Kreis und Helmuth James von Moltkes beeindruckende europäische Vision zu sprechen. Als ich Agnieszka von Zanthier vor rund zehn Jahren kennen lernte, lebte Freya von Moltke noch, und Agnieszka von Zanthier erzählte mir voller Bewunderung vom Engagement dieser großen beeindrucken Persönlichkeit. Diese Begeisterung fehlte im Vortrag, die Frau von Helmuth James von Moltke fand keine Erwähnung, schließlich war sie auch nicht Thema, aber ein bisschen Emotion hätte dem Vortrag nicht geschadet, der ein bisschen zu lang geriet. Dennoch bleiben die Gedanken Helmuth James von Moltkes bemerkenswert, und die Länge des Vortrags ging nicht auf Kosten des Inhalts. Aber wo hier die Emotion fehlte, war sie zu Beginn der Eröffnungsveranstaltung völlig fehl am Platz:
Nun muss man wissen, dass auch die fortschrittlichste Stiftergemeinde (als die ich die Gesamtheit der Stiftungstagsteilnehmer hier bezeichne), die sicher politisch weiter links steht als die Stiftergemeinde vor 15 Jahren, immer noch von einer gewissen Sattheit geprägt ist, aufgewachsen in Friedenszeiten, keine Not, keinen Hunger kennend, keinen Krieg durchlebt, keine Freunde in der Schlacht verloren. Wenn vor einem solchen Auditorium eine Chansonette mit einem Akkordeonisten zwei Chansons zum besten gibt, kann so ein Programmpunkt gute Laune machen. Aber nicht jedes Lied ist gleich geeignet. Und wer, bitte, ist verantwortlich für die Auswahl des zweiten Liedes, das da hübsch unterhaltsam der satten zufriedenen Zuhörerschar serviert wurde? Das traurige, schöne, bittere Partisanenlied „Bella Ciao“ wurde da lustig gesungen, und es hätte kaum etwas gefehlt, dass da auch noch in den Reihen schenkelklopfend mitgeklatscht worden wäre. Die Zuhörer hatten offenbar genug Feingefühl, nicht in dieser Form miteinzustimmen. In „Bella Ciao“, einem Lied der italienischen Partisanen gegen den Faschismus, geht es um Leben und Tod, um Menschen, die für die Freiheit der anderen zu sterben bereit sind. Das stimmt nachdenklich. Ich mache ja gerne mal einen Scherz mit. Aber was sollte das? Musste man als nächstens vielleicht das Lied von den Moorsoldaten erwarten? Das hat mir jedenfalls die Eröffnungsveranstaltung sauber verdorben. Bella Ciao? Ciao Feingefühl!
Stiftungssatire: Stachel im Fleisch
[Hinweis: Bei dem Text handelt es sich um eine Kolumne, die regelmäßig in den Nachlieferungen des Loseblattwerkes „StiftungsManager“ erscheint. Im Blog wird ab 2015 die Kolumne veröffentlicht, sobald eine Nachlieferung die jeweils nächste, neue Kolumne gedruckt hat. So bleibt der aktuellste Text den Abonnenten des Verlages Dashöfer vorbehalten, und der nächstjüngste Text lädt hier gleichzeitig dazu ein, selbst Abonnent zu werden. Ihre Ansprechpartnerin im Verlag ist Alexandra Benn. Die nachstehende Kolumne erschien in der Nachlieferung 41 im Februar 2015.]
Was darf Stiftungssatire? Darf man sich überhaupt despektierlich über die verdienten Persönlichkeiten, die verdienenden Personen und die dienenden Persönchen äußern, die sich in der Welt der Stiftungen (und außerhalb natürlich auch) tummeln? Oder – je nach Alter und Würde auch: bewegen? Und wer jetzt kurz ins Strafgesetzbuch schauen will oder den einem am genehmsten scheinenden Kommentar zu den Grundrechten aufschlägt oder hofft, im v.Campenhausen/Richter, von Seifart gegründet, einen relevanten Hinweis zu finden, der wird enttäuscht: Kein Hinweis, ob und was Satire im Stiftungswesen darf. Die meiste Satire, selbst leichte Ironie wird gern im Keim erstickt. Oft genug aus vorauseilendem Gehorsam. Weil es dem Stifter sicher nicht gefallen wird. Weil jemand das vielleicht nicht versteht. Weil man selbst nicht darüber lachen kann. Ist doch die eigene Stiftung. Aber genau darum geht es: Wer über sich selbst nicht lachen kann, der hat eh keinen wirklichen Humor. Aber eine Kolumne ändert da nur wenig. Wir machen es heute anders und plaudern nicht, wir gehen besonnen ans Werk und werden überrascht von eine Familienbeziehung.
Man muss nur genau lesen und zuhören können. Dann erfährt man vieles, was man noch nicht wusste, übrigens auch vieles, was man nie wissen wollte. Manches schließlich, was man zu Recht beim besten Willen nicht gedacht hätte. Einer der Herausgeber des StiftungsManagers erfuhr zum Beispiel aus der Fußnote seines Beitrages für das Jahresheft 2015 zum Stiftungswesen, dass er Generalsekretär des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft sei. Bislang war er davon ausgegangen, dass der Generalsekretär den Namen eines großen Baumeisters trug. Aber vielleicht gab es ja früher auch einen großen Baumeister, der Vor- und Nachnamen des Herausgebers trug.
„Lobe dich selbst, wenn dich andere nicht loben!“, stand auf einer dieser großartigen Spruchkarten im Klosterladen am Trierer Matheiser Weiher (in Trier verbrachte der Kolumnist als Kind stets Teile der Schulferien). Da müssen viele Stiftungsvertreter vorbeigegangen sein (und auch der Kolumnist hat den Inhalt durchaus aufgenommen). Was so alles schön geredet und gelobt wird. Rhetorik hat es ja schon weit gebracht, aber alles geht auch nicht. Da ist also bei elf Aufsätzen in einer Sammlung schon ein Schwerpunkt gebildet, weil sich zwei Autoren zum selben Thema äußern? Da ist es ein neuer Rekord, wenn die Zahl der geförderten Projekte die des Vorjahres übersteigt, und sei es auch nur um ein Projekt mehr? Die Superlative in den Berichten über die eigenen Veranstaltungen sind oft ermüdender als ein selbstkritischer Bericht. Aber natürlich darf man auch über Erfolge froh sein und sie als solche benennen. Das gilt aber viel mehr noch für die Mitarbeiter der Stiftung als für die Projekte.
Lob erhalten die Mitarbeiter in vielen Stiftungen eigentlich viel zu selten. Und „das Nichtwahrnehmen von Anerkennung und Lob bei hohem beruflichem Engagement“ kann ein Burnout beschleunigen, lesen wir sinngemäß auf den Seiten des Klaus-Grawe-Instituts, eng verbunden mit der Stiftung gleichen Namens. Stiftungen kümmern sich also auch hier. Wenn das mal nicht ein – ernst gemeintes – Lob wert ist!
Dass die eigene Stiftung kein oder wenig öffentliches Lob erhält, mag den Stifter oder den Stiftungsmanager wurmen. Es ist erträglich, denn eine Stiftung arbeitet nicht auf Zeit (es sei denn, sie hat das Los, als Verbrauchsstiftung auf die Welt zu kommen, dann bleiben ihr nur wenige Jahre, sonst kommt sie nie in die Zeitung). Früher oder später wird auch den Medien auffallen, dass da direkt vor der Haustür der Lokalredaktion seit vielen Jahren eine Stiftung so erfolgreich war, dass sie ins „Land der Ideen“-Programm aufgenommen wurde. Dass es interessant sein könnte, über Stiftungen zu berichten, haben die Leitmedien und ihre Nacheiferer alle erst verstanden, als die Politiker gesagt haben: da entsteht etwas Interessantes, da müssen wir Anreize schaffen. Warum reagieren Altmedien eigentlich immer erst, wenn die Politik reagiert? Da hat es doch sein Gutes, dass wenigstens die Politik wenn nicht regiert, so wenigstens reagiert.
Die vielen Stiftungen haben ihren kleinen bescheidenen Beitrag daran, dass die Politik auf Trab bleibt. Als Unruhestifter, wie sie Herfried Münkler einmal genannt hat (das war 2003, als Fritz J. Raddatz‘ Autobiographie Unruhestifter erschien – wer hat da bei wem …?). Unlängst hat eine niedersächsische Stiftung einen hübschen Zusatztitel bekommen: Da wurde aus der SBK einfach die SBK STÖR. Die SBK war sich keiner störenden Handlung bewusst, als Unruhestifter darf man sich seit Münkler geschmeichelt fühlen, Störenfried will man aber nicht sein. War die SBK auch nicht. Das Kürzel stand für „Stiftung des öffentlichen Rechts“. Die Walter-Stöhrer-Stiftung mit Sitz in Flensburg stört auch nicht weiter: Als nicht rechtsfähige Stiftung fördert sie künstlerischen Nachwuchs und sorgt für einen angemessenen Umgang mit dem Werk des Namensgebers.
Über sprechende Namen kann nie genug geschrieben werden. Und wer passt hier besser als Trude Unruh mit der Stiftung, die sie 1996 gegründet hat und die erst seit 2013 nach der Stifterin benannt ist. Da war vorher noch von grauen Tieren die Rede. Aber inzwischen ahnt man, nein, man weiß: Das Leben der Senioren ist bunt (es muss ja nicht jeder wie Lotti Huber in einem Buch erklären, dass „die Zitrone noch viel Saft“ habe). Satt und bunt soll das Seniorenleben sein, und es wäre schön, wenn jeder auch schon vorher ein abwechslungsreiches, buntes Leben führen kann – in dem Grad, in dem es gesund ist, und so bunt nur, dass es den Nächsten nicht nachhaltig stört. Es sei denn, der Nächste ist ein Mensch mit Arg. Menschen, die sich freuen, wenn dem anderen Schlechtes widerfährt. Die Menschen, die anders wirken oder sogar anders sind als sie, grundsätzlich nicht über den Weg trauen.
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. So lautete ein Aphorismus von Friedrich Schiller, bis man ihn veralberte und vertonte und aus dem bösen Nachbarn die schöne Nachbarin machte, deren schöne Beine vor der eignen Haustür irgendwie nicht in den gewohnten Alltag passen wollen. Von Friedrich Schiller zu Roland Kaiser in einer halben Minute. Ist das schon die Folge des Bologna-Prozesses?
Heben wir das Niveau zum Schluss noch einmal und lesen Heinrich Heine. In seinem Werk „Disputation“, das den Untertitel „Eine poetische Karikatur“ trägt, lässt er im Spanien des 14. Jahrhunderts einen Mönch gegen einen Rabbi antreten. Sie kommen mit liturgischem Geschirr, mit Seelgeräten also, aus denen eine Traditionslinie des Stiftens entsprang. Wer den Disput gewinnt, darf den Besiegten taufen oder beschneiden – je nach Ausgang. Das Gedicht wurde in Österreich verboten, dann auch in Preußen, Bayern, Württemberg, wegen des „in sittlicher und religiöser Beziehung scandalösen Inhalts“. Doch der Schriftsteller und Germanist Bodo Heimann, der in diesem März 80 Jahre alt wird, hat es uns in einem Sammelband 2014 noch einmal nahegebracht. Und auf die Frage, was wir von Heine lernen können, sagt er schlicht: „Nicht den Humor verlieren, der Humor kann bissig sein, man kann seine Feinde der Lächerlichkeit preisgeben. Religiöse Fanatiker sind in der Regel humorlos. Und da Fanatismus mit Menschenverachtung und Gewalt korreliert ist, verdienen Fanatiker, die sich beleidigt fühlen, auch nicht unsere Rücksichtnahme oder gar Entschuldigung:“ So weit Bodo Heimann, der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Kulturwerk Schlesien und Träger zahlreicher Preise kleiner Vereine bis hin zum Grand Prix Méditerranée der Accademia d’Europa. Für alle, die immer noch die Nase rümpfen: Satire hat also mit Humor zu tun.
Herfried Münkler erfand den Unruhestifter 2007. Vermutlich gab es das Konstrukt schon einmal früher, so ganz viel gehört nun auch nicht dazu. Die Berliner Zeitung nennt die Tester von der Stiftung Warentest schon 1995 Unruhestifter, aber das hatte noch keine gesellschaftspolitische Dimension. Erst 2007 war der Begriff so verstanden bewusst in der Welt. Im März 2008 nennt der Focus den Unternehmer Hans Lindner mit seinen zwei Stiftungen einen Unruhestifter. Eine der Lindner-Stiftungen wird verdächtigt, effektiver in der Region zu fördern als die Öffentliche Hand – und die Rede ist immerhin von der niederbayerischen Öffentlichen Hand. Unruhestifter, die Bezeichnung passt. Bernd Kauffmann erhält den Titel „Unruhestifter“ zum 70. am 30. Dezember 2014. Ich könnte noch weiter, aber die Botschaft müsste angekommen sein. Stiftungen wollen Unruhestifter sein, Stachel im Fleisch, unbequem, weil sie zum Nachdenken anregen. „Stachel im Fleisch“ nennt Peter Steinbach im Dezember 2014 etwa die Stiftung Topographie des Terrors, für die er als wissenschaftlicher Berater unterwegs ist.
Stachel im Fleisch, Unruhestifter, unbequem. Nichts anderes will Satire. Auch die leichte Ironie, die sich durch jede dieser Kolumnen zieht. Wo sie verletzt, nur um zu verletzen, oder nachtritt, ist Satire auch nicht besser als die Belachten selbst. Das wird es hier hoffentlich nie geben. Aber was die Funktion des Stachels im Fleisch, des Unruhestifters angeht, in diesem Bezug ist Satire die kleine, freche Schwester der Stiftung, die meist als erwachsene Dame daherkommt. Und wenn die kleine Schwester die große schonen würde, das käme bei den anderen aber gar nicht gut an. Das schließt zu keinem Zeitpunkt und zu keinem Alter für die Stiftung aus, den Humor zu behalten und im Zweifelsfall wegzuhören. Denn wie hieß eine zweite Lieblingskarte im Trierer Klosterladen doch gleich: „Kleine Bosheiten soll man überhören. Es ist christlich – und ärgert mehr.“
[Hinweis: Bei dem Text handelt es sich um eine Kolumne, die regelmäßig in den Nachlieferungen des Loseblattwerkes „StiftungsManager“ erscheint. Im Blog wird ab 2015 die Kolumne veröffentlicht, sobald eine Nachlieferung die jeweils nächste, neue Kolumne gedruckt hat. So bleibt der aktuellste Text den Abonnenten des Verlages Dashöfer vorbehalten, und der nächstjüngste Text lädt hier gleichzeitig dazu ein, selbst Abonnent zu werden. Ihre Ansprechpartnerin im Verlag ist Alexandra Benn. Die nachstehende Kolumne erschien in der Nachlieferung 40 im November 2014.]
Die Robert Bosch Stiftung ist 50 geworden und hat es richtig krachen lassen. In der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom. Moment mal, war da nicht was mit Verbundenheit zum Ländle und Robert Bosch – das haben doch alle Stifter erst vor drei Jahren wieder gelernt, als sie zur Eröffnungsfeier des Stiftungstages den Diavortrag (Arbeitstitel: 150 Jahre Robert Bosch = 150 tolle Infos über die Stiftung) sehen wollen mussten. Was hat die Telekom in Berlin denn mit Robert Bosch in Stuttgart zu tun? Weil in Berlin mehr Aufmerksamkeit ist? Weil die Gäste lieber nach Berlin kommen? Weil die Berliner Repräsentanz der Telekom größer ist als das Berliner Büro der Stiftung in Mitte? Weil keiner ins große traditionsreiche Bosch-Haus in Berlin-Charlottenburg kommen würde? Mehr Sendechancen (oh, Öffentlichkeitsarbeit)? Das erinnert ein bisschen an die Betreute eines Kollegen, der eine Mitarbeiterin des Betreuers beim Auspacken nach dem Umzug helfen sollte. Bei deren Eintreffen hatte die Betreute ihre Kartons aber alle ins Nebenhaus bringen lassen – „weil ja da ein Fahrstuhl ist.“
Und jetzt mitten in die Jubiläumsfeierlichkeiten. Eine glückliche Hand bewies man bei der Auswahl einiger Podiumsgäste – frei nach dem Motto: 1 isch schön. 1plusch isch schöner. Mit Muhammad Yunus, dem Mann der Mikrokredite in Bangladesh, hatte bereits ein Friedensnobelpreisträger zugesagt. Kailash Sathyarti aber war zum Zeitpunkt der Einladung noch gar nicht als Friedensnobelpreisträger 2014 bekanntgegeben. Großes Glück! Die Drähte nicht nur der Telekom liefen heiß.
Das Stiftungsjubiläum also mit zwei Friedensnobelpreisträgern! Aber ist das wichtig? Wenn man sich überlegt, dass in Lindau jedes Jahr auf Initiative einer dieser Stiftungen, deren Namen so lang ist, dass er das Format dieser kleinen Kolumne sprengen würde, dass also in Lindau jedes Jahr Nobelpreisträger in zweistelliger Zahl zusammenkommen, ist das auch wieder nichts Besonderes. Die Lindauer Stiftung feiert jedes Jahr ein Jubiläum mit mehr als zwei Nobelpreisträgern. Der runde 64. Geburtstag der Stiftungsveranstaltung in diesem Jahr war der 13. Geburtstag der Stiftung selbst und verlief so erfolgreich, dass im nächsten Jahr zwischen 40 und 50 Nobelpreisträger erwartet werden. Das soll erstmal irgendeine Stiftung nachmachen…(also bis auf die Nobel-Stiftung vielleicht).
So ein Nobelpreis kann einen aber auch ganz schön nervös machen. Wenn man nicht der Geehrte ist. Wie sieht man dann daneben selbst aus, nur mit – wenn überhaupt – zwei Buchstaben versehen oder geehrt oder betitelt. Niemand weiß, wie es kam, aber zum ersten Mal fand sich plötzlich im Programm das ganze Organigramm der Stiftung hinter dem Namen einzelner Podiumsteilnehmer wieder. Interessant, für welche Bereiche einzelne Geschäftsführer zuständig sind. Orientierung in der Stiftungswelt? Es ist immer gut zu wissen, wer wobei genau Zustände bekommt.
Jubiläen sind schon ein schwieriges Unterfangen. Eine neue Krankheit ist im alten Braunschweiger Land aufgetaucht. Brage Bei der Wieden, der Leiter des Landesarchivs Wolfenbüttel, berichtet von einer ungekannten Jubiläumsverweigerung unter seinen Mitarbeitern. Natürlich nicht mit dieser Wortwahl. Die Niedersachsen kennen zwei Internetportale der Archivverwaltung, in denen sie sich über anstehende Jubiläen informieren können. Rechtzeitig können Redaktionen so vormerken, wann sie über die 50. Wiederkehr eines legendären Bankraubs berichten sollten. Da steht dann in der Ankündigung von 2037, dass es nun 900 Jahre her ist, dass Kaiser Lothar eingekocht wurde, damit man wenigstens seine Gebeine heil nach Königslutter bringen konnte. Und auf den 100. von Ministerpräsident i. R. Ernst Albrecht von Hannover (ohne Herzog) 2030 kann man sich über eines der Portale sicher auch vorbereiten. Als nun die Mitarbeiter (und Mitarbeiterinnen) der Landesarchive gebeten wurden, ein paar derlei hübsche Termine zu nennen, kam keine Antwort zurück; ganz offensichtlich waren die Angestellten (und Angestelltinnen) der Archive und Bibliotheken und die Mitglieder (und Mitgliederinnen) der Historikervereine ausgelaugt nach so viel Jubel, Trubel des Feierns müde und verweigerten sich nun jeder weiteren Zelebrierung (zu den hübschen Genderformen später eine Auflösung). 1914 (alle Franzosen ziehen gegen alle Deutschen zu Felde) war für alle hierzulande Anlass zum Gedenken. Für Braunschweig (und alle alten Preußen nicht minder) kam noch 1913 (alle Welfen heiraten alle Hohenzollern) hinzu; das hat Braunschweig alle Kraft gekostet. Es ist zumeist fraglich, warum man nur in Vierteljahrhunderten rechnet, warum 25 Jahre gefeiert werden, 50, 75, 100, aber nicht die richtig guten Zahlen, althergebrachte „Schnapszahlen“ ebenso wenig wie eigens auf das gefeierte Bauwerk, das hochzulebende Geburtstagskind. Das ist fürs Jubiläum der Stiftungen nicht anders. 55 Jahre Stiftung X könnte man feiern, 77 Jahre Stiftung Y. Tut man aber nicht. 50, 75, 100, anders scheint es nicht zu gehen. Immerhin hatte sich die VolkswagenStiftung 2002 mit der großen Feier zum 40. schon so weit aus dem Fenster gehängt, dass alle Folgestiftungen sich ebenfalls etwas einfallen lassen mussten zu ihrem 40 – ob sie wollten oder nicht. Die Bosch-Stiftung musste 2004 ran, die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 2011. Aber inzwischen ist der Groll verflogen, denn 40 war auch nur eine Übung, eine kleine Vorbereitung für den 50. Die arme Körber-Stiftung musste 2009 ins kalte Wasser springen, denn Kurt A. Körber hat die Stiftung – quasi als frühreifer Stifter – schon 1959 errichtet. Ähnlich ging es der Thyssen-Stiftung, denn am 7. Juli 1959 gaben sich Totengedenken und Zukunftsgestaltung ein Stelldichein, drei Tage später gab es dann von NRW-Innenminister Dufhues den Segen für die gemeinsame Reise durchs Leben. Spannend zu sehen, ob diese Stiftungstradition, den 40. schon groß zu feiern, sozusagen als Generalprobe für den 50., fortgesetzt wird: 2016 wird Gerda Henkel 40, und man ist versucht, jede Aktivität schon im Voraus als Vorbereitung des Jubiläums zu deuten. Vielleicht gibt es den 40. Band aus der Historischen Bibliothek (da müssten aber einige Autoren schnell fertig werden)? Vielleicht ist es aber auch so, dass die Stiftung jedes Jahr so feine Arbeit macht, dass es eines großen Aktes überhaupt nicht mehr bedarf, sich zum 40. schon in den Mittelpunkt zu rücken, zum 50. dann wieder, zum 60. und immer so fort. Man hört schließlich in den seltensten Fällen mit 60 mit der Stiftungsarbeit auf. Ein schönes Vorhaben: sich selbst weniger feiern und die Projekte sprechen lassen.
So eine Studie wie die aktuell vorgestellte „Shape the Future“ der Robert Bosch Stiftung kann man dann trotzdem in Auftrag geben – wenn man unbedingt will. Die Mitarbeiter von Roland Berger haben für kleines Geld (kleiner Scherz, keine Ahnung) Experten und Stiftungsvertreter (da unterscheidet die Studie) rundum befragt. Zum Stiften an sich und zur Arbeit einzelner Stiftungen im Besonderen. Herausgekommen ist – wer hätte das gedacht? – ein Heft, das auf 92 Seiten alles noch einmal zusammenfasst, was wir wissen. Es war eben alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Nichts gegen die Studie: Viele Menschen verinnerlichen nur das, worüber sie selbst geschrieben haben, daher sollten möglichst viele auch über Sinn und Wesen der Stiftungen schreiben. Und was die Studie da zusammenfasst, ist schließlich nicht falsch. Also vielleicht drücken wir da bei den acht Schlaglichtern mal alle acht Augen zu: Schöner hat bislang noch keiner die Zukunft so dargestellt, dass dort genau das eingetreten ist, was man selbst stets vertreten habe. Kostprobe? Nur drei, die machen fast Lust auf mehr: „Gutes tun reicht Stiftungen nicht mehr. Sie haben den Anspruch, das maximal Mögliche zu erreichen“, heißt es da beim Schlaglicht 5. Und kurz vorher, versteckt im Schlaglicht 4: „Immer mehr Stiftungen setzen sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und soziale Marktwirtschaft ein.“ Ach, man will pausenlos weiterzitieren. Einen hab ich noch, wir wandern von Höhepunkt zu Höhepunkt, jetzt sind wir mitten im Schlaglicht 7: „Das Ressourcenmanagement orientiert sich an den strategischen Erfordernissen.“ Da spürt man doch so richtig das Herz und das Herzblut und das Brennen für eine Idee, das den Stifter umtrieb.
Oder die Stifterin. Denn den gewollten Schnitzer von vorhin müssen wir noch kurz auflösen. „Mitgliederinnen“ stand schon vor Jahren in einem Schreiben des Germanistenverbandes (nicht mal des Germanistinnenverbandes). Selbst so lustige Monster wie die Angestelltinnen schleichen sich immer häufiger auch bei Stiftungen ein. Es ist absurd, und vermutlich werden nun ausgerechnet die Stiftungen die Gordische Knötin nicht zerschlagen. Der Grat oder besser die Klamm zwischen Barrierefreiheit und Genderung der Formulierungen wird immer schmaler. Aber da zwängen wir uns nächstes Mal hindurch.
Kurzrezension Andreas Greiner-Napp: EINblick
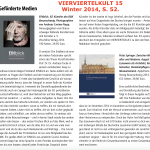 EINblick. 82 Künstler des BBK Braunschweig. Photographien von Andreas Greiner-Napp. Herausgegeben vom Braun- schweiger Bildende Künstlerinnen und Künstler e. V. Vita-Mine Verlag 2014. 190 Seiten, 29,95 Euro.
EINblick. 82 Künstler des BBK Braunschweig. Photographien von Andreas Greiner-Napp. Herausgegeben vom Braun- schweiger Bildende Künstlerinnen und Künstler e. V. Vita-Mine Verlag 2014. 190 Seiten, 29,95 Euro.
O vanitas! Die Eitelkeit als eine der sieben Todsünden spricht schon der Trierer Kunsthistoriker Prof. Dr. Dr. Andreas Tacke in seinem einleitenden Essay zu Andreas Greiner-Napps Fotoband EINblick an. Tacke äußert sich allgemein zu Fragen der Eitelkeit und der Inszenierung von Künstlern und Kunstwerken. Er hebt das handwerkliche Geschick als Voraussetzung dafür hervor, dass der Fotograf in seiner Rolle als Künstler nicht beeinträchtigt ist. Inwieweit die Darstellungsbandbreite der Porträts auch ein Spiegel der Heterogenität der 82 porträtierten Kunstschaffenden ist, wird dem Betrachter auf den Weg gegeben. Der hat zunächst – o vanitas – andere Aufgaben zu lösen: Von Voltaire stammt das hübsche Lehrstück, wir würden uns später im Himmel über dreierlei wundern: Leute zu treffen, die wir niemals dort erwartet hätten, Leute nicht zu treffen, die wir dort sicher geglaubt hätten, und schließlich, uns selbst dort zu treffen. So verbaut sich jeder dritte Braunschweiger – und in keiner Stadt würde das anders laufen oder besser – den ersten frischen Blick auf das Werk, weil er zunächst kritisch schaut, wer da alles drin ist und wie viele man kennt und ob da also auch Bedeutende und Wichtige … Die Grundlage der Auswahl der Porträtierten ist nur eine Mitgliederliste des BBK. Ein großes Werk ist EINblick aus anderem Grund. Andreas Greiner-Napp hat seine Sprache in den Porträts durchsprechen können bis zum letzten, obwohl jedes Porträt das Gespräch dreier Künstler ist: der zweite ist Ingo Lehnhof, der die Porträts mit Kurztexten auf eine Doppelseite des Buches bringen musste – Antworten auf einen festen Fragenkatalog, um die die 82 Künstler gebeten wurden. Als dritter Künstler stets am Bildgespräch beteiligt: der Porträtierte selbst. Über allem quasi als vierte Dimension Jim Rakete, der ein lesenswertes, lobendes Grußwort verfasst hat. Ein spannendes Buch des Fotografen von VIERVIERTELKULT, zu dem der Rest der Redaktion herzlich gratuliert.
