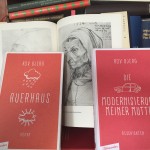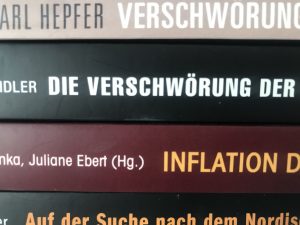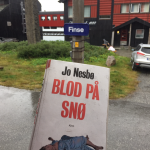Kurzkritik „Retter der Antike: Marquard Gude“
Ausgelesen! Eigentlich hat dieser neue Band der Herzog August Bibliothek zu Wolfenbüttel einen Platz in der Rubrik „Neuerscheinungen“ von VIERVIERTELKULT verdient, aber das nächste Heft kommt frühestens im Dezember 2016, möglicherweise erst im Januar 2017 – und da ist die Ausstellung, die dieser Band begleitet, schon vorüber. Marquard Gude (1635-1689) war ein Gelehrter, wie er für das 17. Jahrhundert typischer kaum sein konnte. Der Wahrheit verpflichtet und doch keinen Konflikt scheuend, brachte er es zu Bekanntheit und Ruhm, als sich Europa langsam von den Schäden des Dreißigjährigen Krieges erholte. Gude, aus dem schleswig-holsteinischen Rendsburg stammend, hat sich selbst einmal als „Retter der Antike“ bezeichnet. Und in der Tat dürfte er manche Handschrift und Inkunabel vor der Vernichtung durch Verrottung oder Zerstückelung bewahrt haben. In Florenz etwa stellte er einen Codex mit einem Text des römischen Dichters Livius sicher. In der Herzog August Bibliothek ist derzeit eine wunderbare Ausstellung zu sehen, die einen Eindruck des Beziehungsgeflechtes gibt, in dem sich ein Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts bewegte. So steht Marquard Gude stellvertretend für ganze Generationen von Gelehrten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien. Einem Gelehrten der übernächsten Generation ist es zu verdanken, dass sich ein Großteil der ehemals Gudeschen Bibliothek heute in Wolfenbüttel befindet (ein anderer Teil findet sich in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar): Gottfried Wilhelm Leibnitz überzeugte als Leiter der Bibliothek Herzog Anton Ulrich im Jahr 1710, die angebotenen Werke für Wolfenbüttel zu sichern. Es war Glück für die Bibliothek – und für die Bücher selbst. Der Begleitband beleuchtet ausführlich das Gelehrtentum, das sich im Erwerb und Gebrauch des Lateinischen und Altgriechischen, im Handschriftenstudium und in ausgeprägter Editionstätigkeit äußerte (Thomas Haye). Mit Uta Kleine wirft der Leser einen Blick in die Bibliothek Marquard Gudes, in der neben den lateinischen Klassikern auch Werke aus Technikwissenschaften, Mathematik und Militärwissenschaften zu finden sind. Die weiteren Beiträge zeigen, dass Gude nicht nur Retter der Antike, sondern auch Retter des Mittelalters war, denn die Gudesche Bibliothek enthält auch eine Reihe mittelalterlicher Handschriften zur Medizin (Iolanda Ventura). Auch zahlreiche Bilder gingen aus der Bibliothek Gudes in den Bestand der HAB über (Michael Wenzel); leider sind sie im Begleitband nur schwarz-weiß wiedergegeben. 478 Bände umfasst die Kollektion der Codices Gudiani: Bertram Lesser beschreibt ihren Stellenwert unter den acht historischen Handschriftenfonds der HAB in seine mAufsatz zur Katalogisierung der Werke in Wolfenbüttel. Wer sich für Wissenschaftsgeschichte interessiert, darf die Ausstellung nicht verpassen, die noch bis 8. Januar 2017 in der Augusteerhalle und im Kabinett der Bibliotheca Augusta gezeigt wird; wer es nicht nach Wolfenbüttel schafft, muss sich auf den ausgezeichneten Begleitband beschränken.
Patrizia Carmassi (Hg.): Retter der Antike. Marquard Gude (1635-1689) auf der Suche nach den Klassikern (= Wolfenbütteler Forschungen Bd. 147). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2016, 576 Seiten mit 129 s/w-Abb. und 20 Farbabb., 82 Euro. ISBN 978-3-447-10659-7.
Kurzkritik Ott & Besa: „All the People“
Angeschaut! Ausgelesen! Dass ich vor einem Monat noch rechtzeitig zur Finissage von „All the People“ in die Neue Galerie Berlin in der Ludwigkirchstraße in Berlin-Wilmersdorf eingeladen wurde, war glückliches Zusammentreffen. Nicht allein, dass die Galerie den Fotos von Bernd Ott den richtigen Rahmen gab. Nicht allein, dass ein Bürgermeisterkandidat durch seine beherzte offene Rede überraschte (auch wenn er sein Wahlziel dann am Folgesonntag verfehlt hatte. Vor allem die Texte zu den Bildern hatten es mir angetan. Wer jahrelang für Süddeutsche Zeitung und andere Medien Bücher besprochen hat und selbst gern Porträts, etwa für VIERVIERTELKULT, schreibt, weiß um die Kunst, Umfangreiches, Inhaltsreiches, Facettenreiches knapp und prägnant zu schildern und treffend zu charakterisieren. Mit dem Foto-Text-Band zu „All the People“ wirkt die Ausstellung nach; der Band lohnt auch für jeden, der die Ausstellung nicht sehen konnte. Emily Besa gelingt dies meisterhaft; sie vermittelt in ihren Porträts das heikle Thema der Geschlechterzugehörigkeit oder eben -nichtzugehörigkeit und beschreibt die Seele jedes einzelnen porträtierten Menschen. Es geht um Individuen, nicht um Geschlechter, noch viel weniger um Rollen. Und sie zeigt, dass die Folge der Erkenntnis, dass das Leben nicht schwarz und weiß sei, nicht ein allgemeines ödes grau ist. Das Leben ist bunt. Die Bilder tun ihr Übriges.
Bernd Ott (Foto) | Emily Resa (Text): All the People. Kerber Verlag, Bielefeld 2016. 245 Seiten, 40 Euro. 978-3-7356-0176-6
https://www.kerberverlag.com/de/all-the-people.html
Ausgelesen! Für eine Besprechung zum Schwerpunkt „Wasser“ des Sommerheftes 2016 von VIERVIERTELKULT kam dieses Buch leider zu knapp. Kaum ein Titel hätte so gut zum Schwerpunktthema gepasst wie „Wasser – Wege – Wissen auf der iberischen Halbinsel“. Immerhin ist das älteste heute noch tagende Gericht ein Wassergericht auf der iberischen Halbinsel: Das Tribunal de Aguas in Valencia tagt seit etwa 700 n. Chr. Welche starken Einflüsse die Wasserpolitik in allen Herrschaftsepochen vom Römischen Imperium über das Westgotenreich bis hin zur muselmanischen Herrschaft hat, zeigt der Tagungsband; dass der größte Teil der Beiträge in spanischer oder englischer Sprache publiziert sind, soll den interessierten Leser nicht abschrecken: Schon die Beiträge über Elemente des römischen Wasserrechts (Cosima Müller) und über erwünschte und unerwünschte Mobilität im westgotischen Spanien (Stefan Esders) lohnen als nützliche Ergänzung der Artikel des VIERVIERTELKULT-Schwerpunktes „Wasser“.
Ignacio Czeguhn | Cosima Möller | Yolanda Quesada Morillas | José Antonio Pérez Juan (Hg.): Wasser – Wege – Wissen auf der iberischen Halbinsel. Vom römischen Imperium bis zur islamischen Herrschaft (= Berliner Schriften zur Rechtsgeschichte Band 6). Nomos-Verlag, Baden-Baden 2016. 384 Seiten, 99 Euro.
Kurzkritik DUNKE-SCHÖN
 Ausgelesen! Gute Braunschweiger Sport-Nachrichten gibt es derzeit vor allem vom Football: Am vergangenen Sonnabend war die Meldung perfekt: Die New Yorker Lions Braunschweig sind elfmaliger und amtierender Deutscher Meister und viermaliger und amtierender Euro-Bowl-Sieger. In der Herbstausgabe von VIERVIERTELKULT, die zur Frankfurter Buchmesse erscheint, schreibt Ralph-Herbert Meyer ausführlich darüber. Doch bei der Freude über den Football sollte man die Basketballer nicht vergessen. Schon im vergangenen Herbst widmete die Edition Braunschweiger Zeitung im Klartext Verlag dem SG Braunschweig anlässlich eines Vierteljahrhunderts in der 1. Basketball-Liga einen umfassenden Band mit Informationen zu allen Spielzeiten, allen Spielern, allen Spielen, den Helden der Anfangszeit und vielem mehr. Für jeden Fan werden Seite für Seite Erinnerungen wach, etwa an das Jahr 1990, als der tschechische Nationalspieler Stefan Svitek als erster Ausländer der Vereinsgeschichte zur SG kam. Der Band ist aber auch für weniger eingefleischte Basketballer aufschlussreich, vor allem weil er auf schøne Weise die Begeisterung zeigt, von der die Redaktion einer Lokalzeitung mitgerissen werden kann.
Ausgelesen! Gute Braunschweiger Sport-Nachrichten gibt es derzeit vor allem vom Football: Am vergangenen Sonnabend war die Meldung perfekt: Die New Yorker Lions Braunschweig sind elfmaliger und amtierender Deutscher Meister und viermaliger und amtierender Euro-Bowl-Sieger. In der Herbstausgabe von VIERVIERTELKULT, die zur Frankfurter Buchmesse erscheint, schreibt Ralph-Herbert Meyer ausführlich darüber. Doch bei der Freude über den Football sollte man die Basketballer nicht vergessen. Schon im vergangenen Herbst widmete die Edition Braunschweiger Zeitung im Klartext Verlag dem SG Braunschweig anlässlich eines Vierteljahrhunderts in der 1. Basketball-Liga einen umfassenden Band mit Informationen zu allen Spielzeiten, allen Spielern, allen Spielen, den Helden der Anfangszeit und vielem mehr. Für jeden Fan werden Seite für Seite Erinnerungen wach, etwa an das Jahr 1990, als der tschechische Nationalspieler Stefan Svitek als erster Ausländer der Vereinsgeschichte zur SG kam. Der Band ist aber auch für weniger eingefleischte Basketballer aufschlussreich, vor allem weil er auf schøne Weise die Begeisterung zeigt, von der die Redaktion einer Lokalzeitung mitgerissen werden kann.
Ute Berndt | Henning Brand | Ingo Hoffmann | Christoph Matthies: Dunke-Schön. 25 Jahre 1. Bundesliga Basketball in Braunschweig (= Edition Braunschweiger Zeitung Band 12). Klartext-Verlag, Essen 2015. 368 Seiten, 19,95 Euro.
Man mag inhaltlich mit ihm übereinstimmen oder nicht: Wolfgang Bosbach gehört zu den wenigen Akteuren der Gesellschaft, denen man noch Herzblut und Rückgrat gleichermaßen anmerkt. Heinz Buschkowsky ist mit ihm in einem Atemzug zu nennen, Hans-Christian Ströbele auch, nur wenige mehr finden sich, die in sich tragen, was man das Regine-Hildebrandt-Gen nennen könnte: Sie regen sich auf, nicht um sich vor der Kamera oder dem Publikum zu produzieren, sondern weil sie unter den gesellschaftlichen Missständen leiden und wirklich etwas zum Guten bewegen wollen. 2017 steht Wolfgang Bosbach nicht mehr zur Wahl für den nächsten Bundestag, nun legt er in Form eines Gespräches mit Hugo Müller-Vogg seinen „Endspurt“ hin. Quadriga aus dem Lübbe Verlag lud heute zur Buchpräsentation ins Humboldt-Carré.
 Edmund Stoiber hielt so etwas wie eine Laudatio und beschrieb Bosbach als „einen der weniger gewordenen Politiker“ (Stoibersche Glanzgrammatik), die heute noch jedem zuhören und die es wirklich interessiere, was die „einfachen Menschen“ fühlten, ob Top-Manager, Baggerführer oder Aldi-Kassiererin. Im anschließenden Gespräch zwischen Bosbach, Müller-Vogg und Stoiber beeindruckt die Ehrlichkeit und Offenheit Bosbachs, der gerne Innenminister geworden wäre (Bosbach: „Aber die Verletztheit gibt sich; und auch wenn ich keine Umfrageergebnisse präsentieren kann: Der Mehrheit der Abgeordneten ist ihr Traum vom Ministerposten nicht in Erfüllung gegangen“). Auf die Frage, was Bosbach als Innenminister anders gemacht hätte, gibt es satte Kritik, kaum noch versteckt, von Stoiber an Thomas de Maizière: In Situationen wie jenen der Gegenwart brauche es „Menschen, die nicht emotionslos agieren.“ Auch Zetsche wird mit Stoibers Kritik bedacht: Der habe die Flüchtlingswelle als den Beginn eines zweiten Wirtschaftswunders bezeichnet; und wie viele Flüchtlinge haben die DAX-Unternehmen eingestellt? „Weniger als 100.“
Edmund Stoiber hielt so etwas wie eine Laudatio und beschrieb Bosbach als „einen der weniger gewordenen Politiker“ (Stoibersche Glanzgrammatik), die heute noch jedem zuhören und die es wirklich interessiere, was die „einfachen Menschen“ fühlten, ob Top-Manager, Baggerführer oder Aldi-Kassiererin. Im anschließenden Gespräch zwischen Bosbach, Müller-Vogg und Stoiber beeindruckt die Ehrlichkeit und Offenheit Bosbachs, der gerne Innenminister geworden wäre (Bosbach: „Aber die Verletztheit gibt sich; und auch wenn ich keine Umfrageergebnisse präsentieren kann: Der Mehrheit der Abgeordneten ist ihr Traum vom Ministerposten nicht in Erfüllung gegangen“). Auf die Frage, was Bosbach als Innenminister anders gemacht hätte, gibt es satte Kritik, kaum noch versteckt, von Stoiber an Thomas de Maizière: In Situationen wie jenen der Gegenwart brauche es „Menschen, die nicht emotionslos agieren.“ Auch Zetsche wird mit Stoibers Kritik bedacht: Der habe die Flüchtlingswelle als den Beginn eines zweiten Wirtschaftswunders bezeichnet; und wie viele Flüchtlinge haben die DAX-Unternehmen eingestellt? „Weniger als 100.“
 Beinahe ein bisschen zu kurz gekommen sind bei der Buchvorstellung Bosbachs Erinnerungen an Begegnungen und Erlebnisse. Aber dafür ist ja das Buch gedacht. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Lektüre.
Beinahe ein bisschen zu kurz gekommen sind bei der Buchvorstellung Bosbachs Erinnerungen an Begegnungen und Erlebnisse. Aber dafür ist ja das Buch gedacht. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Lektüre.
Wolfgang Bosbach: Endspurt. Wie Politik tatsächlich ist – und wie sie sein sollte. Begegnungen, Erlebnisse, Erfahrungen. Ein Gespräch mit Hugo Müller-Vogg. Quadriga bei Lübbe, Bergisch-Gladbach 2016. 272 Seiten, 24 Euro.
In der Herbstausgtabe der DHIVA sind gerade meine Kurzkritiken zu fünf aktuellen Titeln unter der Überschrift „Von Verschwörung, Verdummung und Vorurteilen“ erschienen
Vor fast 60 Jahren schrieb der französische Poststrukturalist Roland Barthes über Mythen des Alltags. Mythos ist für Barthes ein Wahrnehmungsphänomen, das die Komplexität menschlicher Handlungen ignoriert und so Evidenz vortäuscht. Die Dialektik ist ausgehebelt. Stephanie Wodianka und Juliane Ebert haben zum aktuellen Stand der Mythenforschung eine Anthologie herausgegeben. Bemerkenswert ist etwa Heike Pauls Darstellung nordamerikanischer Gründungsmythen vom Entdecker Kolumbus über Pocahontas bis zu den Founding Fathers. Claudia Jünke macht im Spanischen Bürgerkrieg gar einen ganzen Mythenkomplex aus.
Wer anhand eines bis heute verbreiteten Mythos die Wirkungsmechanismen von Evidenz und Vereinfachung verfolgen will, kommt an Thomas Etzemüllers Suche nach dem Nordischen Menschen kaum vorbei. Bis heute ist die Ansicht verbreitet, sozial „wertvolle“ Karrierefrauen der „Mittelschicht“ bekämen zu wenige Kinder, während kinderreiche Migrantinnen der Nachwelt die kulturelle Identifizierung erschwerten.
Vom Mythos zur Verschwörungstheorie ist es nur ein kleiner Schritt. Auch letztere wird glaubhaft durch Reduzierung der Komplexität. Verschwörungstheoretiker beharren auf ihrem Recht: Ein Dementi ist für sie nur ein weiterer Beleg ihrer Behauptung. Karl Hepfer zeigt Verschwörungstheorien als Kehrseite der Vernunft. Wem die Aufklärung zu schnell geht, der oder die flüchtet sich schnell in abstruse Theorien der Verschwörung entweder der Illuminati, der Juden, der „Kopftuchmädchen“, der Außerirdischen oder wer noch alles als schwarzer Peter oder schwarze Petra herhalten muss.
Wie mit allem in der Welt lässt sich auch mit Verschwörungstheorien Geld machen. Ob es sich dabei um eine Verschwörungsindustrie handelt oder ob wir es nur mit einem Geschäftsmodell zu tun haben, kann uns gleich sein. John David Seidler legt mittels Quellenanalyse schlüssig dar, wie sich Verschwörungstheorien über jeweils aktuelle Medien verbreiteten, sei es die Mär vom Buchhändlerkomplott gegen Kirche und Krone an der Wende zum 19. Jahrhundert durch Lektüreanweisungen der Gegenaufklärer, sei es der Golfkrieg durch CNN, sei es der 11. September 2001 durch das Internet. Auch zu Ursprung und Verbreitung von Aids stoßen wir immer wieder auf absurde Theorien, die ähnlich viel Wahrheitsgehalt besitzen wie das Kinderbuch von der großen Käseverschwörung.
Wem das immer noch zu wenig praktisch ist, kann gleich zu Nina Horaczeks und Sebastian Wieses Handbuch Gegen Vorurteile greifen. Konsequent zerlegen Autorin und Autor ein Vorurteil über Migrantinnen und Migranten nach dem anderen. „Ausländer kriegen viel mehr Kinder als wir?“ In Österreich etwa liegt eine ganz andere Gruppe bei der Größe der Kinderschar vorne: die Bäuerinnen. Horaczek und Wiese verweisen das Vorurteil ins Reich der Mythen. Dass sie mit „Mythos“ nicht genau dasselbe meinen wie Roland Barthes und die Mythenforschung, ist zweitrangig. Es sollte zur Pflichtlektüre für alle werden, die öffentlich das Wort ergreifen wollen.
Stephanie Wodianka, Juliane Ebert (Hg.): Inflation der Mythen? Zur Vernetzung und Stabilität eines modernen Phänomens. Transcript Verlag, Bielefeld 2016. 978-3-8376-3106-7. 327 Seiten, 34,99 Euro.
Thomas Etzemüller: Auf der Suche nach dem Nordischen Menschen. Die deutsche Rassenanthropologie in der modernen Welt. Transcript Verlag, Bielefeld 2015. 978-3-8376-3183-8. 291 Seiten, 29,99 Euro.
Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft. Transcript Verlag, Bielefeld 2015. 978-3-8376-3102-9. 189 Seiten, 24,99 Euro.
John David Seidler: Die Verschwörung der Massenmedien. Eine Kulturgeschichte vom Buchhändler-Komplott bis zur Lügenpresse. Transcript Verlag, Bielefeld 2016. 978-3-8376-3406-8. 368 Seiten, 39,99 Euro.
Nina Horaczek, Sebastian Wiese: Gegen Vorurteile. Wie du dich mit guten Argumenten gegen dumme Behauptungen wehrst. Czernin Verlag, Wien 2015. 978-3-7076-0493-1. 190 Seiten, 17 Euro.
Ausgelesen! Auerhaus, zu Recht hochgelobt im Literarischen Quartett, wirkt noch intensiver nach, wenn man auch Bov Bjergs Geschichten und Fragmente gelesen hat, die unter dem Titel Die Modernisierung meiner Mutter bei Blumenbar herausgekommen sind (die Titelgeschichte gibt es gleich in zwei Teilen). Schon am ersten Satz der ersten Geschichte wird klar, was den Autor von einigen zu Unrecht gepriesenen Autoren unterscheidet. Der Anfangssatz von Schinkennudeln hat jedenfalls das Zeug dazu, mein neuer schønster erster Satz zu werden (ich hatte beim damaligen Wettbewerb Der schønste erste Satz immerhin „Ilsebill salzte nach“ eingeschickt – und obwohl der Satz schließlich auch gewann, nicht selbst gewonnen; vermutlich war meine Begründung zu schlicht). Bjergs Geschichte beginnt: „Schinkennudeln waren immer mein Lieblingsessen, aber einmal habe ich davon gekotzt.“ Eine Castorf- oder Neuenfels-Inszenierung wird nicht deswegen gut, weil jemand auf die Bühne kotzt – und Bjergs Stil ist auch nicht gut, weil er „kotzen“ schreibt. Aber wo andere Verwaltungsdeutsch schreiben und etwas etwa „vollumfänglich“ tun, geht dem Autor hier alles leicht von der Hand. Dass mit Zwei Minuten Revolution und Howyadoin zwei für mich sperrige Geschichten unter den vielen guten sind, tut der Leichtigkeit keinen Abbruch. Bjerg will nicht gefallen, nicht um jeden Preis klug klingen, nicht um jeden Preis lustig sein. So viel Originalität erfrischt – und verführt; denn jenen, der sich bei Auerhaus in die gute Zeit der Jugend zurücklehnt und zurückverliebt, holt das traurige Ende jäh in die Gegenwart zurück – und der Kloß im Hals des Lesers beim Zuschlagen des Romans ist echt.
Bov Bjerg: Auerhaus. Roman. Blumenbar, Berlin 2015. 236 Seiten, 18 Euro.
Bov Bjerg Die Modernisierung meiner Mutter. Geschichten. Blumenbar, Berlin 2016. 151 Seiten, 18 Euro.
Kurzkritik Jürgen Jankofsky: 2x „Merseburg“
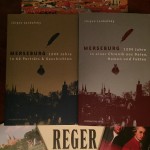 Ausgelesen (und ausgesungen)! Am vergangenen Sonnabend war der Philharmonische Chor Berlin wieder einmal bei den Merseburger Orgeltagen zu Gast, diesmal mit Regers 100. Psalm (den ich schon einmal vorher gesungen habe, am 4. Dezember 2011, damals aber in der Berliner Philharmonie). Wer über die großartige Akustik und die beeindruckende Orgel des Doms zu Merseburg hinaus noch mehr über die wechselvolle Geschichte der Stadt Merseburg erfahren will, kommt an den beiden Büchern von Jürgen Jankofsky, eine Chronik der 1200-jährigen Geschichte und einen Geschichtenband, nicht vorbei. Gut an den Büchern ist eine kluge Ausgewogenheit der Themen, zu denen die Vorstellung der Merseburger Zaubersprüche durch Wilhelm von Humboldt in Berlin und das Fremdeln der Merseburger als neue Einwohner Preußens ab 1815 und ihrer langsam erwachenden Zuneigung zu Kleist von Nollendorf genauso gehören wie der Beginn der Ammoniak-Herstellung nach dem Haber-Bosch-Verfahren 1917 in der Nähe von Merseburg. Der kleine Kurt Biedenkopf ging hier von 1938 bis 1945 zur Schule, hier verweigerte man 1977 Rudolf Bahro 1977 die Promotion. Und vieles mehr.
Ausgelesen (und ausgesungen)! Am vergangenen Sonnabend war der Philharmonische Chor Berlin wieder einmal bei den Merseburger Orgeltagen zu Gast, diesmal mit Regers 100. Psalm (den ich schon einmal vorher gesungen habe, am 4. Dezember 2011, damals aber in der Berliner Philharmonie). Wer über die großartige Akustik und die beeindruckende Orgel des Doms zu Merseburg hinaus noch mehr über die wechselvolle Geschichte der Stadt Merseburg erfahren will, kommt an den beiden Büchern von Jürgen Jankofsky, eine Chronik der 1200-jährigen Geschichte und einen Geschichtenband, nicht vorbei. Gut an den Büchern ist eine kluge Ausgewogenheit der Themen, zu denen die Vorstellung der Merseburger Zaubersprüche durch Wilhelm von Humboldt in Berlin und das Fremdeln der Merseburger als neue Einwohner Preußens ab 1815 und ihrer langsam erwachenden Zuneigung zu Kleist von Nollendorf genauso gehören wie der Beginn der Ammoniak-Herstellung nach dem Haber-Bosch-Verfahren 1917 in der Nähe von Merseburg. Der kleine Kurt Biedenkopf ging hier von 1938 bis 1945 zur Schule, hier verweigerte man 1977 Rudolf Bahro 1977 die Promotion. Und vieles mehr.
Jürgen Jankofsky: Merseburg. 1200 Jahre in einer Chronik aus Daten, Namen und Fakten. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2015. 431 Seiten, 12,95 Euro.
Jürgen Jankofsky: Merseburg. 1200 Jahre in 62 Porträts & Geschichten. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2013. 280 Seiten, 9,95 Euro.
Wer die Mechanismen der Argumentation von Verschwörungstheoretikern nicht kennt, kann ihnen anfangs auf den Leim gehen. Gleich mehrere Neuerscheinungen, besprochen in der Herbst-DHIVA 2016, geben einen Überblick und schlagen Antworten vor.
Verschwörung, Verdummung und Vorurteile
Mythen unseres Alltags zusammengefasst
Stephanie Wodianka, Juliane Ebert (Hg.): Inflation der Mythen? Zur Vernetzung und Stabilität eines modernen Phänomens (= Edition Kulturwissenschaft Band 72). Transcript Verlag, Bielefeld 2016. 978-3-8376-3106-7. 327 Seiten, 34,99 Euro.
John David Seidler: Die Verschwörung der Massenmedien. Eine Kulturgeschichte vom Buchhändler-Komplott bis zur Lügenpresse. Transcript Verlag, Bielefeld 2016. 978-3-8376-3406-8. 368 Seiten, 39,99 Euro.
Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft (= Edition Moderne Postmoderne). Transcript Verlag, Bielefeld 2015. 978-3-8376-3102-9. 189 Seiten, 24,99 Euro.
Thomas Etzemüller: Auf der Suche nach dem Nordischen Menschen. Die deutsche Rassenanthropologie in der modernen Welt (= Science Studies). Transcript Verlag, Bielefeld 2015. 978-3-8376-3183-8. 291 Seiten, 29,99 Euro.
Nina Horaczek | Sebastian Wiese: Gegen Vorurteile. Wie du dich mit guten Argumenten gegen dumme Behauptungen wehrst. Czernin Verlag, Wien 2015. 978-3-7076-0493-1. 190 Seiten, 17 Euro.
Fast 60 Jahre ist es her, da versammelte der französische Poststrukturalist Roland Barthes in einem kleinen Bändchen von ihm beobachtete „Mythen des Alltags“. Mythos ist für Barthes ein Wahrnehmungsphänomen, das die Komplexität menschlicher Handlungen abschafft und so Evidenz vortäuscht. Die Dialektik ist ausgehebelt. Seit 1957 ist die Mythenforschung weiter, und Stephanie Wodianka und Juliane Ebert haben den aktuellen Stand in einer aufschlussreichen Aufsatzsammlung zusammengefasst. Bemerkenswert ist etwa Heike Pauls Darstellung der nordamerikanischen Gründungsmythen, vom Entdecker Kolumbus über Pocahontas bis zu den Founding Fathers. Claudia Jünke schließlich macht im Spanischen Bürgerkrieg einen ganzen Mythenkomplex aus.
Wer anhand eines bis heute in weiten Teilen der Bevölkerung immanenten Mythos die Wirkungsmechanismen von Evidenz und Vereinfachung verfolgen will, kommt an Thomas Etzemüllers Suche nach dem Nordischen Menschen nicht vorbei. Auch heute noch finden viele, sozial „wertvolle“ Karrierefrauen der „Mittelschicht“ bekommen zu wenige Kinder, während kinderreiche Migrantinnen der Nachwelt die kulturelle Identifizierung erschwerten.
Vom Mythos zur Verschwörungstheorie ist es nur ein kleiner Schritt. Auch letztere wird nur glaubhaft durch Reduzierung der Komplexität. Im Gegensatz zu Trägern oder Verkündern von Mythen beharren aber Verschwörungstheoretiker auf ihrem Recht: Sie allein sagen die Wahrheit, ein Dementi ist für sie ein weiterer Beleg ihrer Behauptung. Karl Hepfer zeigt in einem flüssig beschriebenen Buch, wie Verschwörungstheorien die Kehrseite der Vernunft sind. Wem die Aufklärung zu schnell geht, der oder die flüchtet sich schnell in abstruse Theorien der Verschwörung entweder der Illuminati, der Juden, der Jesuiten, der Kopftuchmädchen, der Außerirdischen oder wer noch alles als schwarzer Peter oder schwarze Petra herhalten mag.
Wie mit allem in der Welt lässt sich auch mit Verschwörungstheorien trefflich Geld machen. Ob es sich dabei um eine ganze Verschwörungsindustrie handelt oder ob wir es nur mit einem Geschäftsmodell zu tun haben, kann uns eigentlich gleich sein. John David Seidler hat nun die wirtschaftlichen, kulturgeschichtlichen und medienrelevanten Aspekte untersucht mittels Quellenanalyse, wie die großen Verschwörungstheorien über jeweils aktuelle Medien besondere Verbreitung fanden, sei es jene , sei es die Mär vom Buchhändlerkomplott gegen Kirche und Krone an der Wende zum 19. Jahrhundert durch durch Lektüreanweisungen der Gegenaufklärer, sei es der Golfkrieg durch CNN, sei es der 11. September 2001 durch das Internet. Auch zur Entstehung und Verbreitung von Aids stoßen wir immer wieder auf absurde Theorien, die ähnlich viel Wahrheitsgehalt besitzen wie das Kinderbuch von der großen Käseverschwörung.
Wem das alles immer noch zu wenig praktisch ist, möge ohne Umwege zu Nina Horaczeks und Sebastian Wieses kleinem Handbuch „Gegen Vorurteile“ greifen. Es ist überraschend und entwaffnend, wie konsequent Vorurteil nach Vorurteil über Migrantinnen und Migranten zerlegt wird. „Ausländer kriegen viel mehr Kinder als wir?“ In Österreich etwa liegt eine ganz andere Gruppe bei der Größe der Kinderschar vorne: die Bäuerinnen. Horaczek und Wiese verweisen das Vorurteil ins Reich der Mythen. Dass sie mit „Mythos“ nicht genau dasselbe meinen wie Roland Barthes und die Mythenforschung, ist zweitrangig. Es sollte zur Pflichtlektüre für alle werden, die öffentlich das Wort ergreifen wollen.
Kurzkritik Jo Nesbø: „Blod i snø“
Ausgelesen! Jo Nesbøs Kriminalgeschichte lässt es keineswegs an der Brutalität fehlen, für die der Autor bekannt ist. Aber die Schilderung des Dyslexie-geplagte Olav Johansen, der nüchtern betrachtet ein Auftragskiller ist, erzeugt so viel Wärme und Mitgefühl beim Leser, dass der Schnee der Weihnachtstage 1975 im kältesten Winter seit Menschengedenken, an denen der Autor seinen Roman spielen lässt, beinahe schmilzt. Da wird selbst die Hinrichtung des Vaters durch Olav für den Leser zum Gnadenakt für Olavs geschundene Mutter. Eines stimmt bei diesem fehlerlos komponierten Buch aber nachdenklich: Olav ist trotz Dyslexie belesen wie kein anderer, kennt Victor Hugos „Les Miserables“ in- und auswendig, geht von Kindesbeinen an regelmäßig in die Deichmanske bibliotek. Gerät man so schon an den Rand der Osloer Gesellschaft der Siebzigerjahre?
Jo Nesbø: Blod i snø. Krimi. Aschehoug, Oslo 2015. 173 Seiten, 79 NOK.