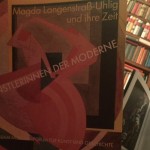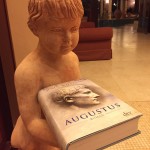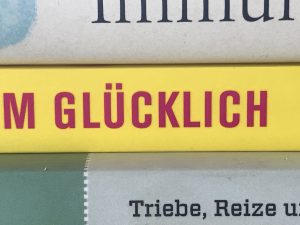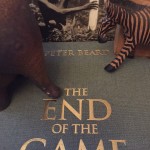Kurzkritik Böszörményi: In den Furchen des Lichts
Ausgelesen! Jetzt ein Roman zum Thema Flüchtlinge? Lesen wir nicht schon genug in den Medien über Obergrenzen, Durchgangslager, Asylanträge, Gewalttaten, Familienzusammenführung, Ängste, Hoffnungen, Flüchtlingsströme? Wir lesen genug, und genau darum sei der Roman jedem ans Herz gelegt, der sich jenseits der Tagespolitik – wie auch immer er konkret dazu stehen mag – für wirkliche Literatur begeistert. Der Mitteldeutsche Verlag hat Zoltán Böszörményis Roman In den Furchen des Lichts völlig zu Recht in seine Bibliothek der Entdeckungen aufgenommen. Dieser Roman ist eine Entdeckung, dieser Autor ist bislang viel zu unbekannt im deutschen Sprachraum. Er gehört zu den vielen ungarischen Muttersprachlern, deren Heimat nicht Ungarn ist. Ungarn hat, wie erst kürzlich wieder in der Literaturzeitschrift die horen zu lesen war, 1918 zwei Drittel seines Staatsgebietes verloren. Böszörményi ist in Rumänien geboren und aufgewachsen und gerät dort mit seinen ersten Lyrikbänden in den Fokus der Securitate. Über Österreich wandert er in den 1980er Jahren nach Kanada aus. 2011 schreibt er seinen Flüchlingsroman Regál, der fünf Jahre später unter dem Titel In den Furchen des Lichts erstmals auf Deutsch erscheint. Es ist ein Roman, der sprachlos macht: Tamás ist Flüchtling und berichtet als Ich-Erzähler von seiner gesamten Zeit im Durchgangslager. Kleines Glück, große Hoffnung, kleine Enttäuschung, großer Betrug und dann wieder in anderen Dimensionen in wechselnder Reihenfolge, Tamás schreibt über seine Erlebnisse mit Freunden und Feinden innerhalb und außerhalb des Lagers, bei den Behörden und der Polizei, mit Schleusern, Arbeitgebern und flüchtigen Gefährtinnen. Von der Kontaktaufnahme zur Familie, von Gesundheitsuntersuchungen, Bierbesorgungen, physischer und psychischer Pein. Aber es ist durchweg kein hoffnungsloser, trostloser Bericht. Und wer das Buch zum Schluss aus der Hand legt, wird vielleicht zum ersten Mal ein Gefühl dafür haben, was es heißt, ein Flüchtling oder Geflüchteter zu sein. Unbedingte Leseempfehlung!
Zoltán Böszörményi: In den Furchen des Lichts. Roman. Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke (= Bibliothek der Entdeckungen). Mitteldeutscher Verlag, Halle 2016. 240 Seiten, 24,95 Euro.
Kurzkritik Magda Langenstraß-Uhlig
Angeschaut! Das neue Jahr hat mit einem Ausstellungsbesuch angefangen, und ein Ausstellungskatalog soll der erste Buchtipp für dieses Jahr sein. Leider liegt die diesem Katalog zugrunde liegende Ausstellung bereits ein knappes Jahr zurück. Aber dieses Buch ist zeitlos – und die Zusammenstellung der Künstlerinnen kommt so schnell nicht wieder. 17 Künstlerinnen versammelt der Bildband. Sie alle lebten in der erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, das Leben der Hälfte von ihnen ist untrennbar mit Berlin verbunden. Aber leicht hatten sie es auch hier nicht: Während Männer, die sich zur Kunst berufen fühlten, sich an den Akademien Deutschlands zum Künstler ausbilden lassen konnten, war dieser Zugang Frauen noch verwehrt. Wie kurzsichtig die Bildungs- und Kulturpolitik früherer Zeiten war, belegen die 17 Künstlerinnen jede für sich. Keine steht den männlichen Kollegen in Fähigkeit, Fertigkeit, Programmatik oder Ideenreichtum nach, auch wenn nicht jeder Aspekt bei jeder Künstlerin zum Tragen kam (aber das ist bei den männlichen Kollegen ja nicht anders). Auch wenn ich sonst skeptisch bin bei der Zusammenstellung von Ausstellungen und Sammelbänden nach Geschlechtskriterium, ergibt die Künstlerinnengruppe dieses Bandes einen Sinn. Sie alle mussten in der gleichen Zeit berufliche und gesellschaftliche Hindernisse nehmen. Hinten im Bild zu erkennen ist Jeanne Mammens Bildnis einer Frau mit Katze. Den Titel ziert Der Tanz von Magda Langenstraß-Uhlig – die Künstlerin steht im Mittelpunkt des Bildbandes. Hannah Höch kennt man, Käthe Kollwitz natürlich auch. Aber viele Entdeckungen sind dabei. Oder kennen schon alle Sella Hasse Julie Wolfthorn und Gertrude Sandmann? Diese und viele andere Künstlerinnen stellen sich in diesem von schlüssigen Texten begleiteten Bildband vor.
Jutta Götzmann | Anna Havemann | Potsdam-Museum (Hg.): Magda Langenstraß-Uhlig und ihre Zeit. Künstlerinnen der Moderne. Lukas Verlag, Berlin 2015. 159 Seiten, 25 Euro.
Kurzkritik John Williams: Augustus
Ausgelesen! John Williams‘ Briefroman Augustus ist eine späte Entdeckung. Schon viel ist über Kaiser Augustus und die lange Friedenszeit geschrieben worden, die seine Herrschaft für das römische Volk bedeutete. Fasziniert von der Antike schauen wir Monumentalfilme, lesen Historienschinken und besuchen Themenparks zu Römern, Griechen und Germanen. Wie das Leben im alten Rom tatsächlich verlief, vermögen aber nur die wenigsten Werke zu vermitteln. John Williams‘ Augustus gehört dazu. Der amerikanische Autor, gestorben 1994, schrieb seinen Roman bereits Anfang der 1970er Jahre. Dass er jetzt endlich auch in deutscher Sprache vorliegt, ist das Verdienst des Deutschen Taschenbuch Verlages. Der Autor nähert sich der Person Octavianus Augustus multiperspektiv: Briefe, Tagebücher, Gesetze, Erinnerungen, Verlautbarungen hat John Williams erfunden, um aus vielen kleinen Steinen ein Mosaik entstehen zu lassen, das uns die Handlungen des Kaisers, die res gestae, wenn man sie so nennen will, plausibel erklärt und uns einen Blick ins Innere der Macht vorspiegelt. Alles ist Fiktion und doch auch wieder nicht: Wie schwul Gaius Cilnius Maecenas nun wirklich war, mit wie vielen Männern Julia, des Kaisers Tochter, nun tatsächlich geschlafen hat und ob sich Gespräche und Gelage bis in alle Einzelheiten wie beschrieben abspielten, bleibt der Phantasie des Lesers überlassen. Bei allem aber bleibt John Williams glaubwürdig. Ein wunderbarer Briefroman über Freundschaft, Liebe, Intrige und besonnene Politik. Und ein zusätzlicher Genuss für alle, die lange genug Latein gelernt haben, dass sie Caesar, Livius und Ovid im Original gelesen haben: John Williams schreibt, als seien alle Texte frisch aus dem Lateinischen ins Amerikanische (und weiter ins Deutsche) übersetzt. Dringende Leseempfehlung.
John Williams: Augustus. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Bernhard Robben und mit einem Nachwort von Daniel Mendelssohn, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2016. 474 Seiten, 24 Euro.
Vom Impfen und Therapieren – Kurzkritiken in der DHIVA
Die Diskussion ums Impfen taucht jedes Jahr spätestens anlässlich der Grippeimpfung wieder auf. Meinen Rezensionen aus der DHIVA vorangestellt noch ein viraler Kalauer, dessen Ursprung ich nicht kenne. Falls jemand mehr weiß, freue ich mich über einen Hinweis.
Eula Biss: Immun. Über das Impfen – von Zweifel, Angst und Verantwortung. Aus dem Englischen von Kirsten Riesselmann. Carl Hanser Verlag, München 2016. 978-3-446-44697-7. 236 Seiten, 19,90 Euro.
Oliver Gralla: Untenrum glücklich. Eine urologische Handreichung. Bastei Lübbe, Köln 2016. 978-3-404-60918-5. 206 Seiten, 15 Euro.
Sonja Walch: Triebe, Reize und Signale. Eugen Steinachs Physiologie der Sexualhormone. Vom biologischen Konzept zum Pharmapräparat, 1894-1938 (= Wissenschaft, Macht und Kultur in der modernen Geschichte Band 6). Böhlau Verlag, Wien 2016. 978-3-205-20200-4. 274 Seiten, 40 Euro.
Maik Tändler: Das therapeutische Jahrzehnt. Psychoboom, Politik und Subjektivität in den 1970er Jahren (= Veröffentlichungen des zeitgeschichtlichen Arbeitskreises Niedersachsen Band 30). Wallstein Verlag, Göttingen 2016. 978-3-8353-1850-2. 360 Seiten, 49,90 Euro.
Jedes Jahr Anfang Dezember steht mit dem Welt-Aids-Tag die Therapie im Zentrum des Interesses. Die Frage nach neuen Wegen bei der Bekämpfung von HIV ist ein kleiner Baustein in unserer komplexen Welt, die sich mit der Behandlung oder Verhinderung von Krankheiten beschäftigt. Dass dies in ganz unterschiedlicher Art und Weise möglich ist, was wissenschaftlichen Anspruch, Niveau und Charakter der Störung betrifft, zeigen vier Neuerscheinungen.
Ein leichter Weg, eine Krankheit zu vermeiden, scheint die Impfung zu sein – wenn es einen Impfstoff gibt und wenn wir jenen nicht ebenfalls als Übel betrachten, bei dem wir den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Die US-Amerikanerin Eula Biss hat ein ausgewogenes Buch über das Impfen geschrieben. Ausgewogen nicht, weil sie sich selbst nicht entscheidet; sie selbst ist im Zweifel fürs Impfen. Ausgewogen aber, weil sie Verständnis für Gegenargumente aufbringt. Plausibel legt sie dar, warum eine Impfung im Vergleich mit einer Krankheit keinesfalls die größere Monstrosität ist. Was haben wir Menschen nicht alles geglaubt: Dass Impfstoffe Formaldehyd enthalten oder Quecksilber. Dass die Injektion Syphilis übertrage, stimmte sogar einmal – vor hundert Jahren. Eula Biss nimmt, was das Impfen angeht, alle Ängste.
Das Impfmanifest kommt gut ohne Doktortitel aus; bei der urologischen Handreichung steht der Titel sogar auf dem Cover: Oliver Gralla klänge wohl inkompetent, da muss Dr. Gralla her. Männern wie Frauen die Angst vor Urologie, Andrologie, Gynäkologie mit einem beherzten Ratgeber zu nehmen, ist gut gemeint, in diesem Fall aber nicht gut. Man bekommt jede Antwort auch bei Dr. Internet, und zwar ohne alberne Synonyme wie dem „rosa behelmten Liebeskrieger“ oder Schilderungen der Australienreise befreundeter Eltern mit Kinderwunsch.
Was man nicht im Internet findet, ist die Geschichte von Eugen Steinachs Physiologie der Sexualhormone, die Sonja Walch auf hohem Niveau erzählt. Der Wiener Arzt wunderte sich über die Verjüngung von Mensch und Tier und findet die Ursache in Liebe und Sexualität. Ab 1894 forschte er erst über Nerven und Triebe, dann über Hormone, Reize und Signale. Über Steinach stieg die Firma Schering in den Sexualhormonmarkt ein, doch Steinach muss 1938 ins Exil – das ihm als Sexualhormonforscher in den USA versagt wird; er stirbt 1944 in der Schweiz.
Einen weit größeren Einfluss auf das Verstehen von Trieben und Signalen hat ein Zeitgenosse Steinachs, ebenfalls aus Wien: Siegmund Freuds Lehre löste in den 1970ern einen wahren Psychoboom aus. Wie die Verwissenschaftlichung des Selbst zu dessen Befreiung und Demokratisierung führte, schildert der Historiker Maik Tändler. Er macht die 1970er als das Jahrzehnt aus, in dem sich die „psychologische Menschenführungsexpertise“ breit zu etablieren begann. Bis in die Einzelheiten lohnt die Lektüre, wie sich die Psychologie vom Nischenfach zur therapeutischen Leitwissenschaft entwickelt. Das wird sie bleiben. Denn gegen psychische Störungen gibt es keine Impfung.
Kurzkritik Michael Klein: „Mark Twain in München“
Ausgelesen! Den Winter 1878/79 verbrachte Mark Twain mit seiner Familie in München. Die Stadt war nur eine von vielen Stationen auf seiner Reise durch Europa, und in Twains Bummel durch Europa, der die Erinnerungen an jene Reise versammelt, taucht München so gut wie gar nicht auf. Erstaunlich eigentlich, denn Twain hat sich in München, entgegen den Eindrücken der Ankunftsnacht, sehr wohl gefühlt. Michael Klein spürt den amerikanischen Dichter in der Pension und in seinem angemieteten Arbeitszimmer in München auf und bildet gelungen die Atmosphäre Münchner Lebens dieser Zeit ab. Mark Twain in München ist Teil der feinen Reihe Stationen aus dem Morio-Verlag, die nicht nur deswegen jedem ans Herz gelegt sei, weil ich selbst dort 2017 einen Band veröffentlichen werde. Von welchem Künstler in welcher Stadt dieser andere Band handeln wird, sei noch nicht verraten.
Michael Klein: Mark Twain in München (= Stationen). Morio Verlag, Heidelberg 2015, ISBN 978-3-945424-13-1, 72 Seiten, 7,95 Euro.
Kurzkritik Peter Beard: The End of the Game
Ausgelesen! Nein, was der Leser beim Aufschlagen des Prachtbandes sieht, will er nicht sehen: ein Elefantenembryo, süß, wie es süßer nicht geht, im Dreck – ganz offensichtlich der Embryo einer trächtig geschossenen Elefantenkuh. Peter Beard hat mit seiner schonungslosen Fotodokumentation über die Großwildjagd vor 50 Jahren Aufsehen erregt und ein für allemal alles Magische, Heroische, das die Großwildjagd mit sich brachte, in das Reich der Legenden verwiesen. Zwei Jahrzehnte lang hat er das Massensterben zehntausender Elefanten, Nashörner und Nilpferde in Afrika dokumentiert, bevor er 1965 einen beeindruckenden Bildband vorlegte. Big Five schießen – zu welchem und wessen Nutzen? Nichts gegen die Jagd an sich, in hiesigen Gefilden, zum kontrollierten Austarieren des Gleichgewichts des Waldes, zum Schutz vor Bissschäden. Aber was vor 50 Jahren in Afrika passierte und teilweise bis heute passiert, ist das letzte Kapitel der Menschheit, bevor sie Vernunft erlangte. Vielleicht geht es in diesen Zeiten wieder los, da der Mensch die Vernunft wieder zu verlieren scheint. Ganz gleich wie wir zur Jagd in Mitteleuropa stehen: Die Verherrlichung der Großwildjagd hat der Reputation der hiesigen Jäger großen Schaden zugefügt. Auch 50 Jahre später ist Beards Anklage, ergänzt um Texte und Bilder von Großwildjägern, Entdeckern und Missionaren noch aktuell. Atemberaubende, aber keine beruhigende Stunden sind dem garantiert, der sich ins Buch vertieft. Der Taschen-Verlag hat das Buch neu aufgelegt.
Peter Beard: The End of the Game. Taschen Verlag, Köln 2015. 282 Seiten, 74,99 Euro.
Ausgelesen: Soeben eingetroffen ist die Winter-DHIVA mit meinen Kurzkritiken von vier Neuerscheinungen unter dem Titel Vom Impfen und Therapieren – obenrum und untenrum.
Jedes Jahr Anfang Dezember steht mit dem Welt-Aids-Tag die Therapie im Zentrum des Interesses. Die Frage nach neuen Wegen bei der Bekämpfung von HIV ist ein kleiner Baustein in unserer komplexen Welt, die sich mit der Behandlung oder Verhinderung von Krankheiten beschäftigt. Dass dies in ganz unterschiedlicher Art und Weise möglich ist, was wissenschaftlichen Anspruch, Niveau und Charakter der Störung betrifft, zeigen vier aktuelle Neuerscheinungen.
Ein leichter Weg, eine Krankheit zu vermeiden, scheint die Impfung zu sein – wenn es einen Impfstoff gibt und wenn wir jenen nicht ebenfalls als Übel betrachten, bei dem wir den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Die US-Amerikanerin Eula Biss hat ein ausgewogenes Buch über das Impfen geschrieben. Ausgewogen nicht, weil sie sich selbst nicht entscheidet; sie selbst ist im Zweifel fürs Impfen. Ausgewogen aber, weil sie Verständnis für Gegenargumente aufbringt. Plausibel legt sie dar, warum eine Impfung im Vergleich mit einer Krankheit keinesfalls die größere Monstrosität ist. Was haben wir Menschen nicht alles geglaubt: Dass Impfstoffe Formaldehyd enthalten oder Quecksilber. Dass die Injektion Syphilis übertrage, stimmte sogar einmal – vor hundert Jahren. Eula Biss nimmt, was das Impfen angeht, alle Ängste.
Das Impfmanifest kommt gut ohne Doktortitel aus; bei der urologischen Handreichung steht der Titel hingegen auf dem Cover: Oliver Gralla klänge wohl inkompetent, da muss Dr. Gralla her. Männern wie Frauen die Angst vor Urologie, Andrologie, Gynäkologie mit einem beherzten Ratgeber zu nehmen, ist gut gemeint, in diesem Fall aber nicht gut. Man bekommt jede Antwort auch bei Dr. Internet, und zwar ohne alberne Synonyme wie dem „rosa behelmten Liebeskrieger“ oder Schilderungen der Australienreise befreundeter Eltern mit Kinderwunsch.
Was man nicht im Internet findet, ist die Geschichte von Eugen Steinachs Physiologie der Sexualhormone, die Sonja Walch auf hohem Niveau erzählt. Der Wiener Arzt wunderte sich über die Verjüngung von Mensch und Tier und findet die Ursache in Liebe und Sexualität. Ab 1894 forschte er erst über Nerven und Triebe, dann über Hormone, Reize und Signale. Über Steinach stieg die Firma Schering in den Sexualhormonmarkt ein, doch Steinach muss 1938 ins Exil – das ihm als Sexualhormonforscher in den USA versagt wird; er stirbt 1944 in der Schweiz.
Einen weit größeren Einfluss auf das Verstehen von Trieben und Signalen hat ein Zeitgenosse Steinachs, ebenfalls aus Wien: Siegmund Freuds Lehre löste in den 1970ern einen wahren Psychoboom aus. Wie die Verwissenschaftlichung des Selbst zu dessen Befreiung und Demokratisierung führte, schildert der Historiker Maik Tändler. Er macht die 1970er als das Jahrzehnt aus, in dem sich die „psychologische Menschenführungsexpertise“ breit zu etablieren begann. Bis in die Einzelheiten lohnt die Lektüre, wie sich die Psychologie vom Nischenfach zur therapeutischen Leitwissenschaft entwickelt. Das wird sie bleiben. Denn gegen psychische Störungen gibt es keine Impfung.
Eula Biss: Immun. Über das Impfen – von Zweifel, Angst und Verantwortung. Aus dem Englischen von Kirsten Riesselmann. Carl Hanser Verlag, München 2016. 978-3-446-44697-7. 236 Seiten, 19,90 Euro.
Oliver Gralla: Untenrum glücklich. Eine urologische Handreichung. Bastei Lübbe, Köln 2016. 978-3-404-60918-5. 206 Seiten, 15 Euro.
Sonja Walch: Triebe, Reize und Signale. Eugen Steinachs Physiologie der Sexualhormone. Vom biologischen Konzept zum Pharmapräparat, 1894-1938 (= Wissenschaft, Macht und Kultur in der modernen Geschichte Band 6). Böhlau Verlag, Wien 2016. 978-3-205-20200-4. 274 Seiten, 40 Euro.
Maik Tändler: Das therapeutische Jahrzehnt. Psychoboom, Politik und Subjektivität in den 1970er Jahren (= Veröffentlichungen des zeitgeschichtlichen Arbeitskreises Niedersachsen Band 30). Wallstein Verlag, Göttingen 2016. 978-3-8353-1850-2. 360 Seiten, 49,90 Euro.
Ausgelesen! Wieder habe ich für die nächste Nachlieferung des Loseblattwerkes StiftungsManger 20 aktuelle Titel aus Stiftungswesen, Zivilgesellschaft, Mäzenatentum und Gemeinnützigkeit durchgearbeitet und rezensiert, wobei auch ich ein Handbuch von 1.900 Seiten (Nomos-Kommentar Gesamtes Gemeinnützigkeitsrecht) nicht von der ersten bis zur letzten Seite lese. Aber die meisten Bücher habe ich durchgelesen, und darunter waren wirkliche Perlen. Als Beispiel bringe ich hier meine Rezension über Michael Knoches Abschiedspublikation – alles andere vollständig beim StiftungsManager im Dashöfer-Verlag.
Ausgelesen! Es gibt wenige Ereignisse, die für die jüngere Geschichte der Stiftungen in Deutschland von so großer Bedeutung sind, dass sich für kurze Zeit der Blick des gesamten Stiftungswesens in dieselbe Richtung wendet. Die Rede ist nicht von geschichtlichen oder gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Wiedervereinigung oder der Migrationswellen, sondern von plötzlichen Katastrophen eines Tages. Zu diesen Katastrophen zählte der Brand der Anna Amalia Bibliothek in Weimar in der Nacht vom 2. September 2004 mit 50.000 verbrannten und 62.000 stark beschädigten Bänden. Es folgte eine beispiellose Rettungsaktion zum Wiederaufbau der Bibliothek und zur Restaurierung der Bücher, an der sich zahlreiche Stiftungen maßgeblich beteiligten. Michael Knoche hatte 1991 die Leitung der Bibliothek übernommen, sein Bericht Die Bibliothek brennt, im Wallstein-Verlag erschienen, hat sich jedem Leser unvergesslich ins Gedächtnis eingebrannt. 2016 ist Knoche in den Ruhestand gegangen, nun legt er mit einer Sammlung von Studien, versammelt unter dem Titel Auf dem Weg zur Forschungsbibliothek, sein Vermächtnis vor, das gleichermaßen Ratgeber für gelungenes Krisenmanagement ist wie Maßgabe zum Umgang mit Kulturgut beim Übergang ins digitale Zeitalter. Dass der Autor auch Paul Raabe mit einem Porträt bedenkt, den Träger des Deutschen Stifterpreises 2001 und Retter der Franckeschen Stiftungen zu Halle, ist schlüssig für das Abschiedswerk Michael Knoches, der ein Vierteljahrhundert Stiftungsgeschichte geschrieben hat.
Michael Knoche: Auf dem Weg zur Forschungsbibliothek. Studien aus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek (= Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie – Sonderband 120). Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2016. 245 Seiten, 69 Euro. 978-3-465-04278-5.
Kurzbesuch HAUM neu eröffnet
Angeschaut! Diesmal war auch die überregionale Presse flink beim Blick in die vermeintliche Provinz – allen ans Herz gelegt sei Benedikt Erenz‘ schøne Schmähung der „Hamburger Lokalautisten“ in der ZEIT. Heute war auch ich im wiedereröffneten erweiterten HAUM (Herzog Anton Ulrich-Museum) in Braunschweig. Ein „Fest der Kunst“ allemal, aber auch ein Fest des Drängelns, ein Fest der Petersburger Hängung und ein Fest des Alarmtones, der alle 10 Sekunden losging. Erste Stimmen beschweren sich über die hohen Eintrittspreise – aber da ist jemand noch nicht sehr weit rumgekommen; die 9 Euro liegen im europäischen Mittel (und Menschen unter 18 zahlen nur 2 Euro). Auch wenn Kunstdichte und Menschenmasse den Genuss leicht schmälern: Fest einplanen!
Herzog Anton Ulrich-Museum, Museumstraße 1, 38100 Braunschweig. Öffnungszeiten dienstags bis sonntags 11-18 Uhr.
Kurzkritik Philipp Winkler: „HOOL“
 Ausgelesen! Seit der aspekte-Literaturpreis mir im Jahr 2000 dabei half, Andreas Maier und Wäldchestag zu entdecken, hat er meine große Sympathie. Nicht immer traf er, wie sollte es anders sein, in den Folgejahren meinen Geschmack; am meisten wohl noch bei Katja Petrowskajas Vielleicht Esther2014. Mit der Lektüre von Philipp Winklers HOOL habe ich schon vor der Juryentscheidung begonnen. Ein passender aspekte-Preisträger ist er allemal, im Stil außergewöhnlich ungewöhnlich, ohne manieriert zu sein, im Thema genauso ausgefallen wie alltäglich. Und doch habe ich einige Tage gebraucht, um durchzukommen. Die Hooligan-Welt ist sicher nicht meine Alltagswelt, aber daran liegt es nicht; schließlich ist so vieles nicht meine Alltagswelt, über das ich lese. Bei manchem Satz kamen mir eben doch Zweifel, ob das auch ein Hooligan so niederschreiben würde, wie es da steht: „Der Hartgummilappen, der an die untere Türkante getackert ist, schrappt über die alten Dielen.“ Und manchmal gehen die Vergleiche mit dem Autor durch: „Die Treppe knarzt wie die Knochen eines alten Mannes.“ Stringent ist die Sprache nicht: „heruntergeglommen“ hier, „dreinschauen“ da. Aber wo er wirkliches Bauchgefühl schildert, ist Winkler meisterhaft, etwa wo Heiko Kai im Krankenhaus besucht und sie sich vom Vorlese-Plug des Internetbrowsers Fußballartikel mit komplizierten Spielernamen vorlesen lassen. Manche Motive muten vertraut an: Den zarten Harten, der die Tauben füttert, kennen wir seit Marlon Brandos Verkörperung des Terry Malloy in Die Faust im Nacken (On the Waterfront), und das war 15 Jahre vor meiner Geburt. Eine hübsche Parallele: Arthur Millers Drehbuchentwurf mit dem Arbeitstitel HOOK stand damals in Verdacht, beim Ausgangstext für On the Waterfront geklaut zu haben. Ob das so war oder umgekehrt, ist bislang nicht abschließend geklärt. Warum soll da nicht HOOL auch ein bisschen beim Film geklaut haben (nur diesmal war es sicher nicht umgekehrt)? Unabhängig davon: Lesenswert ist HOOL auf jeden Fall, und dass die Protagonisten-Hooligans aus Hannover sind und in erster Linie auf die Braunschweiger losgehen, zeigt auch dem Erfinder und Schriftleiter von VIERVIERTELKULT, der Vierteljahresschrift der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dass HOOL sehr wohl zumindest zu kleinen Teilen auch aus seiner Alltagswelt erzählt.
Ausgelesen! Seit der aspekte-Literaturpreis mir im Jahr 2000 dabei half, Andreas Maier und Wäldchestag zu entdecken, hat er meine große Sympathie. Nicht immer traf er, wie sollte es anders sein, in den Folgejahren meinen Geschmack; am meisten wohl noch bei Katja Petrowskajas Vielleicht Esther2014. Mit der Lektüre von Philipp Winklers HOOL habe ich schon vor der Juryentscheidung begonnen. Ein passender aspekte-Preisträger ist er allemal, im Stil außergewöhnlich ungewöhnlich, ohne manieriert zu sein, im Thema genauso ausgefallen wie alltäglich. Und doch habe ich einige Tage gebraucht, um durchzukommen. Die Hooligan-Welt ist sicher nicht meine Alltagswelt, aber daran liegt es nicht; schließlich ist so vieles nicht meine Alltagswelt, über das ich lese. Bei manchem Satz kamen mir eben doch Zweifel, ob das auch ein Hooligan so niederschreiben würde, wie es da steht: „Der Hartgummilappen, der an die untere Türkante getackert ist, schrappt über die alten Dielen.“ Und manchmal gehen die Vergleiche mit dem Autor durch: „Die Treppe knarzt wie die Knochen eines alten Mannes.“ Stringent ist die Sprache nicht: „heruntergeglommen“ hier, „dreinschauen“ da. Aber wo er wirkliches Bauchgefühl schildert, ist Winkler meisterhaft, etwa wo Heiko Kai im Krankenhaus besucht und sie sich vom Vorlese-Plug des Internetbrowsers Fußballartikel mit komplizierten Spielernamen vorlesen lassen. Manche Motive muten vertraut an: Den zarten Harten, der die Tauben füttert, kennen wir seit Marlon Brandos Verkörperung des Terry Malloy in Die Faust im Nacken (On the Waterfront), und das war 15 Jahre vor meiner Geburt. Eine hübsche Parallele: Arthur Millers Drehbuchentwurf mit dem Arbeitstitel HOOK stand damals in Verdacht, beim Ausgangstext für On the Waterfront geklaut zu haben. Ob das so war oder umgekehrt, ist bislang nicht abschließend geklärt. Warum soll da nicht HOOL auch ein bisschen beim Film geklaut haben (nur diesmal war es sicher nicht umgekehrt)? Unabhängig davon: Lesenswert ist HOOL auf jeden Fall, und dass die Protagonisten-Hooligans aus Hannover sind und in erster Linie auf die Braunschweiger losgehen, zeigt auch dem Erfinder und Schriftleiter von VIERVIERTELKULT, der Vierteljahresschrift der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dass HOOL sehr wohl zumindest zu kleinen Teilen auch aus seiner Alltagswelt erzählt.
Philipp Winkler: HOOL. Roman. Aufbau Verlag, Berlin 2016. 311 Seiten, 19,95 Euro.