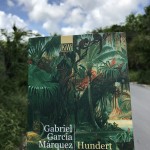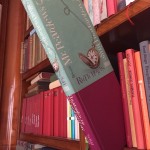Ausgelesen! Einmal im Lesefluss aus Hundert Jahren Einsamkeit, las sich Gabriel García Márquez‘ Chronik eines angekündigten Todes in einem Zug. Waren Hundert Jahre Einsamkeit kaum ein Roman als vielmehr ein Epos, ist die Chronik kaum ein Roman, sondern Erzählung oder gar Novelle, so dicht ist der Bericht von der Ermordung Santiago Nasars. Der Autor tritt wieder einmal selbst auf, diesmal namentlich als Ich-Erzähler, aber noch viel mehr vermisst man nach der Lektüre die ganze Gesellschaft mit so wunderbaren Namen wie Bayardo Sn Román, Suseme Abdala, Escolátisca Cisneros oder Próspera Aranga. Das Bild ist die Illustration nicht zum angekündigten Tod, sondern zum Motiv für den Ehrenmord, als der er klassifiziert wird – besser gesagt: Hätte es so ausgesehen, hätte es keinen Mord gegeben. Aber da war kein Blut in der Hochzeitsnacht … Doch am besten lese man selbst …
Kurzkritik Márquez: „Hundert Jahre Einsamkeit“
Ausgelesen! Hundert Jahre Einsamkeit ist Gabriel García Márquez‘ erstes Werk, das ich gelesen habe, und dann solltenes gleich ein so großes werden. Aber für drei Wochen Mexiko war der wohl berühmteste Roman des kolumbianischen Nobelpreisträgers, der die meiste Zeit seines Lebens in Mexiko gelebt hat und hier auch starb, genau die richtige Wahl. Auch persönlich ein passendes Buch, in dem es doch darum geht, wie sich Familiengeschichte immer von neuem wiederholt, ohne nachlassende Energie, wo die Entwicklung nie aufhört aufzuhören. Einsamkeit als zentrales Motiv, gelbe Falter, vergrabene Josefstatuen und nicht zuletzt Schweineschwänze als feine Seitenmotive. Der Roman ist noch viel mehr als ein Sinnbild der Entwicklung Lateinamerikas. Dass der Autor selbst gegen Ende des Romans auftaucht, ist nur eine von hundert wunderbaren kleinen Ideen am Rande. Das Buch macht in jedem Fall Lust auf noch mehr Márquez.
Kurzkritiken von Neuerscheinungen in VIERVIERTELKULT
 Ausgelesen! Die Gutenberg-Biographie habe ich in meinem Blog bereits gesondert vorgestellt, die anderen Kurzkritiken sind nun erst nach Erscheinen des Sommerheftes von VIERVIERTELKULT nachzulesen. Wer ein paar gute Tipps für Sommerlektüre sucht, findet hier neue Anregungen:
Ausgelesen! Die Gutenberg-Biographie habe ich in meinem Blog bereits gesondert vorgestellt, die anderen Kurzkritiken sind nun erst nach Erscheinen des Sommerheftes von VIERVIERTELKULT nachzulesen. Wer ein paar gute Tipps für Sommerlektüre sucht, findet hier neue Anregungen:
 Durchgeschaut! GÄRTEN heißt das Schwerpunktthema des Sommerheftes von VIERVIERTELKULT. Für diesen Schwerpunkt habe ich wie gewohnt passende, interessante und aktuelle Literatur zum Weiterlesen zusammengestellt. Die Tipps sind auf den Serviceseiten 20-21 zusammengestellt und finden sich zum Nachlesen auch hier:
Durchgeschaut! GÄRTEN heißt das Schwerpunktthema des Sommerheftes von VIERVIERTELKULT. Für diesen Schwerpunkt habe ich wie gewohnt passende, interessante und aktuelle Literatur zum Weiterlesen zusammengestellt. Die Tipps sind auf den Serviceseiten 20-21 zusammengestellt und finden sich zum Nachlesen auch hier:
 Ausgelesen! Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz hat kürzlich drei Neuerscheinungen gefördert, eine kleine Landeskunde Südniedersachsen, einen Band über die Marktkirchenbibliothek Goslar und ein wunderbares Buch über Nachkriegsmoderne im Braunschweiger Land. Meine Kurzkritiken sind im Sommerheft 2017 von VIERVIERTELKULT versammelt – und hier nachzulesen:
Ausgelesen! Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz hat kürzlich drei Neuerscheinungen gefördert, eine kleine Landeskunde Südniedersachsen, einen Band über die Marktkirchenbibliothek Goslar und ein wunderbares Buch über Nachkriegsmoderne im Braunschweiger Land. Meine Kurzkritiken sind im Sommerheft 2017 von VIERVIERTELKULT versammelt – und hier nachzulesen:
Kurzkritik „Kurz & knapp“
Ausgelesen! Der neue Sammelband zu kleinen Textformen bietet neben aufschlussreicher Lektüre auch eine – soweit das überhaupt nötig war – schøne Wertschätzung meiner Kurzkritiken wie auch diese eine ist. Michael Gamper und Ruth Mayer schreiben in ihrem Vorwort: Dass die kurze und knappe Darstellung einen spezifischen Eigenwert hat, dass ihre Erzeugung eine Kunst besonderer, vielleicht höchster Art ist und dass sie gerade wegen ihrer Kondensation Fragen und eine längere Beschäftigung herausfordert, das belegen diese Zeugnisse eindrücklich. Diese Zeugnisse, das sind die versammelten Aufsätze, stellen nicht nur den größten aller deutschen Sprachkünstler Kleist als Meister der kleinen Formen vor – des Rätsels etwa. Sie verbinden mit Hinweis auf Nietzsches Aphorismen das Kurz-Gesagte mit dem Lang-Gedachten und spüren der Wechselwirkung von Erzählen und Wissen in den kurzen Prosaformen der Frühen Neuzeit nach. Die Kurzerzählung bekommt heute längst nicht mehr die Beachtung, die sie verdient, die Novelle hat gegenüber dem Roman das Nachsehen. Dieser Band widerlegt die Annahme, dass „kurz“ auch immer „flach“ heißen muss, und zeigt Verknappung als Kunst. Was nicht heißt, dass jeder, der sich kurz fasst, diese Kunst auch beherrscht. Kurz & knapp ist eine Einladung, wieder mehr Aichinger, Böll, Kaschnitz, Langgässer, Hamsun, Jacobsen oder Øverland zu lesen – und hier die kurzen Texte, die kaum noch jemand kennt. Und warum die Illustration zu dieser Kurzkritik? Wer kleine literarische Formen mag, der ehrt auch seinen Aktenvernichter und liest gerne noch einmal nach. Die kleinste kleine Form ist schließlich der Papierschnipsel…
Michael Gamper | Ruth Mayer (Hg.): Kurz & knapp. Zur Mediengeschichte kleiner Formen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart (= Transcript Edition Kulturwissenschaft). Transcript Verlag, Bielefeld 2017.395 Seiten, 34,99 Euro. 978-3-8376-3556-0.
Kurzkritik Eribon „Rückkehr nach Reims“
Ausgelesen! Mit seiner Rückkehr nach Reims legt Didier Eribon eines der erstaunlichsten Bücher der letzten Jahre vor. Der Autor kehrt nach vielen Jahren anlässlich des Todes seines Vaters in seine Heimatstadt zurück. Den Vater wollte er zu Lebzeiten nicht noch einmal besuchen noch erweist er ihm zur Beerdigung letzte Ehre und letztes Geleit: Zu tief ist der Graben zwischen Vater und Sohn. Aber in der nun folgenden Reflexion über Leben, Herkunft und Familie, über Aufstiegschancen in der Gesellschaft und selbst gewählte Benachteiligung, über Diskriminierung von Minderheiten, Bildungsverachtung und Bildungsbegeisterung kommt Eribon zu frappierenden Erkenntnissen – für sich selbst und für den Leser. Er spürt, dass das Hauptmotiv für seinen Auszug aus Reims und die Entscheidung für Paris möglicherweise nicht sein geplantes, erhofftes und erfolgtes Coming Out war, das ihm in der Hauptstadt leichter fiel. Hauptmotiv war die Leugnung seiner sozialen Herkunft, denn auch später war er stets peinlich berührt, wenn er auf Personalbögen den Beruf der Eltern angeben musste (Hilfsarbeiter und Putzfrau). Aber Eribon erklärt noch viel mehr: warum Menschen aus dem Prekariat plötzlich rechts wählen, welche Verantwortung dafür der Linken zukommt (und wie sie dagegenwirken könnte), welchen täglichen Erniedrigungen jeder Schwule bis heute ausgesetzt ist, auch wenn die meisten Mechanismen entwickelt haben, damit zu leben. Und zwischen allem Hinweise auf Sartre, Bourdieu und Foucault, die wieder mal Lust auf viele, viele theoretische Texte machen. Das gelingt in dieser Form nur wenigen. Ob allerdings die Rückkehr nach Reims auf die Bühne gebracht werden soll und kann – die Berliner Schaubühne hat den Text ins Programm genommen –, bezweifle ich stark. Es bleibt eine wenn auch überschaubare Menge an Texten, die man sich lesend aneignen sollte. Eribons Gedanken zu dramatisieren, ist doch eher Ausdruck einer Konsumgesellschaft, die sich nichts mehr lesend in der Privatheit aneignen will und sich auch solch einen großen Text in vorgefertigter Portion an einem Abend servieren lassen will … also falls einer wirklich nur ins Theater gehen will. Die Rückkehr nach Reims sollte jeder vorher auch selbst gelesen haben.
Didier Eribon: Rückkehr nach Reims. Aus dem Französischen von Tobias Haberkorn. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017 [2016]. 238 Seiten, 18 Euro. 978-3-518-07252-3.
Kurzkritik „Harz und Arkadien“
Ausgelesen! Mit der umfangreichen Ausstellung von Werken des Landschaftsmalers Pascha Johann Friedrich Weitsch hat sich das Gleimhaus in Halberstadt in die erste Reihe kultureller Orte in Deutschland gestellt. Weitsch ist für seine Gemälde der braunschweigischen Eichenwälder bekannt – nicht so bekannt, wie er es verdient hat, aber schon VIERVIERTELKULT hat dem Künstler der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Artikel gewidmet, passenderweise im Sommerheft 2014, das Wald zum Schwerpunkt machte. Der wunderbare Beitrag von Reinhold Wex auf den Seiten 54-56 des Sommerheftes von VIERVIERTELKULT liest sich auch heute als gute Einführung in die Aufsatzsammlung des Begleitbandes zur Ausstellung im Gleimhaus. Weitsch malte nicht nur in Öl, er war auch Porzellanmaler und Lackmaler. Alle drei Kunstrichtungen sind in der Ausstellung versammelt, deren Katalog auch jenen zu empfehlen ist, die es nicht bis zum 17. September 2017 nach Halberstadt schaffen. Die Großformate der Eichenwälder sind weiterhin Weitschs Meisterwerke, die hier friedlich weidenden Rinder erinnern nicht nur an arkadischen Frieden, sondern auch an paradiesische Urzustände aus Haydns Schöpfung. Doch auch jenseits der Meisterwälder haben Ausstellung und Katalog wahre Schätze gehoben.
Reimar F. Lacher (Hg.): Harz und Arkadien. Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723-1803). Landschaftsmaler der Aufklärung. Katalog zur Ausstellung im Gleimhaus Halberstadt. Gedruckt mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt, der Richard Borek Stiftung ,Dirk Grollmann und Martin Rohr. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2017. 152 Seiten, 19,95 Euro. 978-3-95462-903-9.
Kurzkritik „Gebaute Geschichte“
Ausgelesen! Das Frühlingsheft von VIERVIERTELKULT widmete seinen Schwerpunkt dem Thema „Rekonstruktionen“. Für die Buchempfehlungen auf den Serviceseiten kommt das Buch aus dem Wallstein-Verlag über gebaute Geschichte leider zu spät. Aber der neue Sammelband über historische Authentizität im Stadtraum, erschienen als Publikation des gleichnamigen Leibnitz-Forschungsverbundes, passt zum Thema wie kaum ein zweiter. Daher sei er hier im Blog als Nachtrag zum aktuellen VIERVIERTELKULT zur Lektüre empfohlen. Er zeigt, wie wenig sensibel zum Teil bei der Rekonstruktion alter Bauten vorgegangen wird und wie vorhandene Originalsubstanz Besuchern wie Bewohnern der Städte vermittelt wird. Besonders empfehlenswert drei Beiträge: Kathrin Zöllers Artikel „Das ist kein Schloss!“ über die Debatte um den Wiederaufbau des Potsdamer Stadtschlosses (wer die aktuelle VIERVIERTELKULT zur Hand hat, vergleiche mit meiner Einleitung auf Seite 4, da gibt es doch deutliche Parallelen in Formulierungen und Gedanken), Olaf Gisbertz’ Betrachtungen zur Aktualität des Zeitgeistes – vor allem dargelegt am Modell Braunschweig – und Hanno Hochmuths Beschreibung verschiedener Konzepte des Berliner Geschichtstourismus von StattReisen über die Dampferfahrten der Berliner Geschichtswerkstatt bis hin zu den Zeitreisen mit ihren Videobustouren. Aber auch die übrigen 13 Beiträge vermitteln einen guten Eindruck davon, dass der Streit um das Kreuz auf der neuen alten Schlosskuppel längst nicht der letzte Streit (und längst nicht der größte) gewesen sein wird, dem das Berliner Stadtschloss – oder sagen wir Humboldt-Forum – ausgesetzt ist. Auf dem Titel des neuen Bandes, sehr passend, ein sehr aktuelles Foto der Berliner Kuppel im Rohbau. Da brauchte man sich nicht für oder wider das Kreuz zu positionieren.
Christoph Bernhardt | Martin Sabrow | Achim Saupe: Gebaute Geschichte. Historische Authentizität im Stadtraum. Eine Publikation des Leibnitz-Forschungsverbundes Historische Authentizität. Wallstein Verlag, Göttingen 2017. 328 Seiten, 29,90 Euro. 978-3-8353-3013-9.
Ausgelesen! Mit Ruth Hogans Roman Mr. Peardews Sammlung der verlorenen Dinge war ich schon vor dessen Erscheinen in Deutschland Mitte Mai durch. Aber ich war skeptisch, ob ich etwas dazu schreiben sollte. Ich schreibe so ungern Verrisse. Und es ist nicht mal ein richtiger Verriss, eher ein Fall, bei dem man ein ungutes Gefühl hätte, wenn Denis Scheck in seiner Literatursendung das Buch in die Tonne werfen würde. Denn das würde er. Hogans Geschichte ist nicht dumm konstruiert, es ist eine nette Idee, verlorene Dinge zu sammeln und sie zu archivieren, um sie einst ihren früheren Besitzern zurückzugeben und diesen so eine Freude zu machen. Aber es ist ein bisschen viel Freude hier und Freude da im Buch. Die Autorin hat Verständnis für alle, schreibt von niedlichen Hunden, von einem sympathischen, klugen Downie, von heilenden Wunden, vergehendem Liebeskummer, von Freundschaft, schønen Teestunden und vielen Glücksmomenten. Sogar für Menschen mit Blasenproblemen bringt die Autorin Verständnis auf, jede Leserin und jeder Leser findet hier Trost und Bestätigung. Und so ist der Roman, der viel versprechend beginnt – die erste zwischengeschaltete Kurzgeschichte über ein verlorenes Puzzleteil ist wirklich fein ausgedacht und durchaus kunstvoll erzählt – und dann nach und nach enttäuscht, nicht viel mehr geworden als ein Witwen- und Waisentrösterbuch. Schade eigentlich, denn so unbegabt ist die Autorin gar nicht.
Ruth Hogan: Mr. Peardews Sammlung der verlorenen Dinge. Aus dem Englischen von Marion Balkenhol. List bei Ullstein Buchverlage, Berlin 2017. 317 Seiten, 18 Euro. 978-3-471-35147-5.