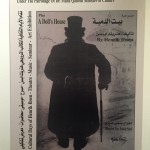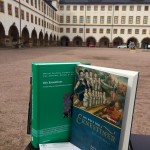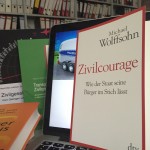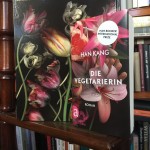Kurzkritik Gonsholt & Westerberg: „Here Be Dragons“
Angeschaut! Alle som har muligheten til å reise til Skien innen 17. september, anbefales å besøke utstillingen Here Be Dragons av Stine Gonsholt og Cecilia Westerberg i Spriten Kunsthall. Wer bis zum 17. September in Skien vorbeikommt, sollte sich die Ausstellung Here Be Dragons von Stine Gonsholt und Cecilia Westerberg in der Kunsthalle Spriten anschauen. Die Installationen der beiden Künstlerinnen zeigen, wie sich neue Räume erschließen, wie wir unbekanntes Land in Besitz nehmen und wie unterschiedliche Gesellschaften verschiedener Epochen mit unbekanntem Gelände umgehen. Auf den Bildern zu sehen „Ink on paper (a history of imagination)“ und „Ab Orgine (according toWegener)“ von Gonsholt und zwei Arbeiten von Westerberg zu Dürers Apokalypse und Collagen, inspiriert von „The 100“.
Spriten Kunsthall, Tømmerkaia 19, 3732 Skien
bis 17. September 2016, Mi-Sa 12-16 Uhr.
Kurzkritik: Johns+Munch
Abgeschaut! Heute im Munch-Museum in der Ausstellung „Johns+Munch“. Wie leicht ist doch Epigonentum zu haben! Einmal „E.M.“ In die Ecke geschrieben, ein paar Jahresringe und ein lose hingelegter Arm, und schon hat man eine Doppelausstellung mit Edvard Munch sicher. Ist jedenfalls der oberflächliche erste Gedanke. Und dann entdeckt man immer mehr subtile Hinweise und innere Verbindungslinien und freut sich über eine intelligent von John B. Ravenal kuratierte Ausstellung mit dicker Bewachung.
Johns+Munch, Munch-Museet, Tøyengata 53, 0578 Oslo
Kurzkritik: Nora Around the World
Angeschaut! Heute war ich in der Osloer Nationalbibliothek, wo ich viele Wochen meines Lebens zugebracht habe für Magisterarbeit 1996 und Doktorarbeit 2012. Unbedingt ansehen: spannende Ausstellung Nora Around the World über die weltweite Wirkung von Nora – ein Puppenheim (hier zu sehen u. a. ein Plakat einer Inszenierung in Damaskus aus dem Jahr 2000). Ibsens Drama von 1879 dürfte mehr für die Emanzipation getan haben als irgendein anderes literarisches Werk überhaupt. In China ist Noraismus das Wort für Feminismus. In Indien entfernt Nora den Puder aus ihrem Haar, der dort Symbol der verheirateten Frau ist.
 Und in Malawi spielt man eine Bearbeitung des Stückes unter dem Titel Breaking the Pot. Was offenbar das passende Bild wider Unterdrückung und Ungleichheit ist. Feine Ausstellung mit lustigen Filmausschnitten u. a. mit Jane Fonda und Anthony Hopkins (n i c h t im selben Film).
Und in Malawi spielt man eine Bearbeitung des Stückes unter dem Titel Breaking the Pot. Was offenbar das passende Bild wider Unterdrückung und Ungleichheit ist. Feine Ausstellung mit lustigen Filmausschnitten u. a. mit Jane Fonda und Anthony Hopkins (n i c h t im selben Film).
Nora around the World. Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110 (Solli plass), Oslo
9. Juni bis 17. September 2016. Mo-Fr 9-18 Uhr, Septembersamstage 9-14 Uhr.